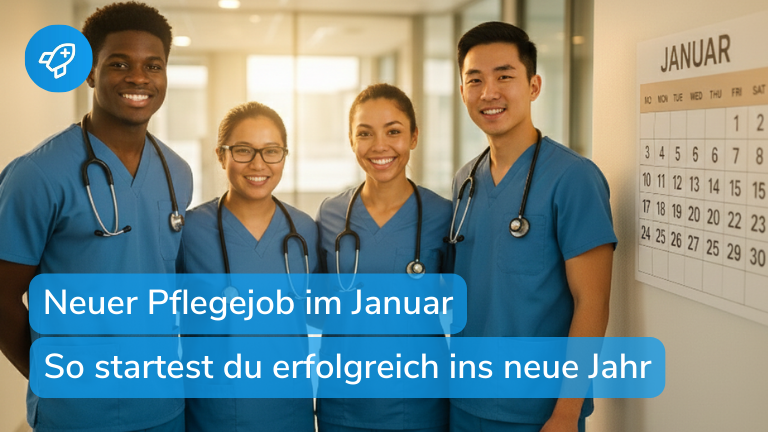Erfahrung 4-Tage-Woche in der Pflege – warum das Klinikum Bielefeld es ausprobiert hat
Silvan Schroeren: Herr van Gellekom, Sie haben mit dem Klinikum Bielefeld vor zweieinhalb Jahren die Vier-Tage-Woche eingeführt – ein Projekt, das viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Möchten Sie sich für unsere Leser und Leserinnen kurz vorstellen?
Henrik van Gellekom: Mein Name ist Henrik van Gellekom. Seit 2019 bin ich hier am Klinikum Bielefeld, das sich aktuell auf dem Weg zum Universitätsklinikum befindet. Wir sind mitten in einer spannenden Transformationsphase. Vor zweieinhalb Jahren – mitten aus der Corona-Situation heraus – haben wir uns überlegt, wie wir die Arbeitsbedingungen für unsere Pflegeteams verbessern können. So ist die Idee entstanden, neue Modelle auszuprobieren, die für mehr Attraktivität im Beruf sorgen.
Wichtig ist dabei: Das Klinikum Bielefeld ist ein 24/7-Betrieb. Wir können nicht einfach sagen, wir arbeiten nur von Montag bis Donnerstag, wie vielleicht eine Werbeagentur oder Kanzlei. Bei uns ist rund um die Uhr etwas los, und genau das macht es interessant, ein solches Modell wie die Vier-Tage-Woche überhaupt zu denken und in der Praxis umzusetzen.
Wie die Idee zur Vier-Tage-Woche entstand
Silvan Schroeren: Sie haben die Vier-Tage-Woche inzwischen schon eine ganze Weile umgesetzt. Wie ist es damals überhaupt dazu gekommen, dass Sie gesagt haben: Wir probieren das jetzt aus?
Henrik van Gellekom: Während der Coronapandemie waren wir maximal belastet, da blieb kaum Raum für neue Ideen. Anfang 2023 entspannte sich die Lage, wir konnten wieder mehr nach vorn denken. Da stellte sich die Frage: Wie können wir Pflegekräfte gewinnen und den Beruf attraktiver machen?
Die Vier-Tage-Woche war damals überall in den Medien und Work-Life-Balance ein großes Thema. Für die Pflege gibt es kein klassisches Homeoffice, aber wir wollten trotzdem ein Zeichen setzen. In einer Gesprächsrunde habe ich dann spontan gesagt: „Lasst uns doch eine Vier-Tage-Woche einführen.“ Unser Geschäftsführer meinte nur: „Dann mach doch.“ Also haben wir es nicht totgeplant, sondern einfach ausprobiert – mit dem klaren Ziel, im Tarifvertrag zu bleiben und alle Vorteile wie Zulagen und Zusatzurlaub zu erhalten.
Am Ende sind es bei Vollzeit neun-Stunden-Dienste, also streng genommen 4,25 Tage pro Woche. Aber „Vier-Tage-Woche“ klingt verständlicher und attraktiver – und so haben wir das Projekt gestartet.
Erste Schritte und Einbindung der Teams
Silvan Schroeren: Wie haben Sie die Teams in die Einführung der Vier-Tage-Woche eingebunden?
Henrik van Gellekom: Wir sind direkt auf die Teams zugegangen und haben gefragt, ob sie das Modell ausprobieren wollen. Zuerst hat sich ein Team gemeldet. Als ein zweites Team hörte, dass sie damit die Ersten in Deutschland wären, die im Krankenhaus eine Vier-Tage-Woche arbeiten, wollten sie sofort mitmachen. So entstand eine richtige Dynamik: Beide Teams – eines am Standort Rosenhöhe, das andere am Standort Mitte – starteten gemeinsam im Juli 2023.
Geplant war eine sechsmonatige Testphase. Doch schon im Dezember haben wir entschieden, daraus eine Dauerlösung zu machen.
Wichtig ist: Die Vier-Tage-Woche läuft bei uns nicht allein, sondern neben anderen Arbeitszeitmodellen. Wir haben zum Beispiel auch einen Flexpool und spezielle Dienste für Eltern oder Mitarbeitende in besonderen Lebenssituationen, etwa von 8 bis 14 Uhr. So bleibt die Arbeitszeitgestaltung vielfältig und flexibel.
Erfahrung aus Sicht der Mitarbeitenden
Unterschiedliche Generationen – unterschiedliche Bedürfnisse
Silvan Schroeren: In den Medien wird oft über die Generation Z gesprochen, wenn es um Themen wie Work-Life-Balance geht. Merken Sie Unterschiede zwischen den Generationen, wenn es um die Vier-Tage-Woche geht?
Henrik van Gellekom: Unterschiede zwischen den Generationen sehen wir kaum. Wir haben das Modell zwar nicht wissenschaftlich begleitet, aber immer wieder Anfragen von Studierenden, die es untersuchen. Dabei zeigt sich: Es gibt keine klare Linie nach Alter oder Geschlecht. Manche frisch Examinierten sagen: „Ich brauche jetzt möglichst viel Praxis, sonst vergesse ich wieder, was ich gelernt habe.“ Sie wollen lieber im klassischen Modell arbeiten. Andere, auch kurz vor der Rente, finden die neun Stunden perfekt und genießen die zusätzlichen freien Tage.
Entscheidend ist die persönliche Lebenssituation. Wer es versteht und zu seinem Alltag passend findet, nimmt das Modell gerne an. Und wer merkt, dass es gerade nicht passt – wegen Familie, Hund oder Pflege der Eltern –, kann jederzeit zurück in ein anderes Modell. Auf dem Dienstplan ist das nur ein Kürzel, das sich flexibel ändern lässt.
Wichtig ist nur: Man kann die Vier-Tage-Woche nicht allein im Team einführen. Es braucht immer mehrere Kolleg:innen, die gemeinsam umsteigen, damit keine Lücken entstehen und nicht der Eindruck entsteht: „Der ist ja mittwochs nie da.“ Bewerber:innen von außen können dagegen direkt in jedem Team mit dem Modell starten – da ist es unkomplizierter.
Mehr Erholung durch zusätzliche freie Tage?
Silvan Schroeren: Welches Feedback erhalten Sie von Ihren Mitarbeitenden? Spüren sie durch die Vier-Tage-Woche tatsächlich mehr Entlastung und Erholung?
Henrik van Gellekom: Das Feedback hat zwei Dimensionen. Zum einen verändert sich die Arbeit selbst – dazu kommen wir gleich noch, wenn es um die Patientenversorgung geht. Zum anderen geht es um die Mitarbeitenden: Die Dienstpläne mischen sich flexibler, es können ein bis sechs Tage Arbeit und danach ein bis sechs Tage frei sein. Auch jedes zweite Wochenende bleibt Dienst, aber innerhalb dieser Struktur gibt es viel Spielraum zum Tauschen.
Klar, achtmal neun Stunden am Stück sind anstrengend. Aber die Aussicht, danach fast eine ganze Woche frei zu haben – ohne Urlaub nehmen zu müssen –, empfinden viele als großen Vorteil. Manche fahren dann einfach nach Holland zum Angeln oder nutzen die freie Zeit für Familie und Erholung.
Auswirkungen der 4-Tage-Woche auf Patientenversorgung und Arbeitsalltag
Silvan Schroeren: Wie sieht eine typische Woche in der Vier-Tage-Woche für Pflegekräfte konkret aus?
Henrik van Gellekom: Aus dem Pilotprojekt sind inzwischen über 100 Mitarbeitende in die Vier-Tage-Woche gewechselt, auch ganze Stationen wie eine Intensivstation. Der Frühdienst startet wie gewohnt um 6 Uhr und endet um 15:30 Uhr. Der Spätdienst geht bis 22 Uhr. Durch die neun Stunden entstehen rund zweieinhalb Stunden Überlappung, in denen Früh- und Spätdienst gemeinsam arbeiten. Diese Zeit bringt viele Vorteile – für Übergaben, für Absprachen und auch für die Stimmung auf Station. Statt dass eine Tür mit „Übergabe – bitte nicht stören“ geschlossen ist, können Übergaben am Patientenbett stattfinden. Die Mitarbeitenden sehen gemeinsam den Zustand der Patient:innen, und die Patient:innen erleben, wer sie weiter betreut.
Bessere Übergaben und mehr Zeit für Ausbildung
Silvan Schroeren: Welche Vorteile hat dieses Modell für Ausbildung und Patientenversorgung?
Henrik van Gellekom: Die zusätzliche Überlappungszeit gibt uns mehr Ruhe für Ausbildungssituationen, zum Beispiel beim Legen eines Dauerkatheters. Solche Dinge lassen sich planen, gemeinsam durchführen und nachbereiten – ohne Hektik. Auch komplexe Interventionen wie die Bauchlage bei Intensivpatient:innen sind dadurch sicherer. Statt dass vier Pflegekräfte gebunden sind und zu wenig Personal für die übrigen Patient:innen bleibt, können wir solche Maßnahmen bewusst in die Überlappungszeit legen. Dann stehen mehr Hände zur Verfügung und es entsteht kein Risiko für die übrigen Patient:innen.
Dokumentation und Organisation im neuen 4-Tage-Modell
Silvan Schroeren: Neben Ausbildung und Versorgung spielt auch die Dokumentation immer eine große Rolle. Hat die Vier-Tage-Woche hier etwas verändert?
Henrik van Gellekom: Ja, eindeutig. Dokumentation ist ja immer ein Thema. Früher hieß es oft: „Wir hatten keine Zeit dafür.“ Jetzt ist nach der Übergabe theoretisch noch einmal anderthalb Stunden Zeit, um in Ruhe zu dokumentieren. Das entlastet die Teams spürbar. Gleichzeitig hat das auch einen finanziellen Aspekt: Durch gute Dokumentation – zum Beispiel in der Geriatrie mit der Komplexpauschale – kann ein Krankenhaus zusätzliche Erlöse erzielen. So wird die Vier-Tage-Woche nicht nur für Mitarbeitende, sondern auch für die Klinik attraktiv.
Feedback von Patient:innen zur 4-Tage-Woche in der Pflege
Silvan Schroeren: Welches Feedback bekommen Sie von den Patient:innen zur Vier-Tage-Woche?
Henrik van Gellekom: Ein Krankenhaus ist natürlich kein Wellness-Hotel. Für Patient:innen ist es immer eine belastende Situation. Deshalb will ich nicht behaupten, dass das Arbeitszeitmodell eins zu eins auf die Stimmung der Patient:innen durchschlägt. Entscheidend ist, dass sie wissen: Wo muss ich wann hin, welche Informationen bekomme ich?
Was wir aber merken: Die Mitarbeitenden können ihre Arbeit besser strukturieren und gehen entspannter in ihre Schichten, weil sie mehr Zeit haben. Das wirkt sich indirekt auch auf die Versorgung aus. Einzelne Patient:innen haben uns auch schon zurückgemeldet, dass sie das Gefühl haben, wir hätten mehr Zeit.
Am deutlichsten sieht man es in den Abläufen. Ein Beispiel: Auf einer geriatrischen Station macht der Chefarzt morgens Visite. Die 85-jährige Patientin liegt noch im Bett, ohne Frühstück, alles ist hektisch. Im neuen Modell findet die Visite später statt. Die Patientin hat gegessen, sitzt angezogen am Bett oder im Aufenthaltsraum und sagt: „Herr Professor, schauen Sie mal, wie gut es mir geht.“ Gleiche Patientin, gleiches Krankheitsbild, aber durch angepasste Abläufe entsteht ein viel besseres Ergebnis.
Herausforderungen bei Dienstplanung und Personalbesetzung trotz 4-Tage-Woche
Silvan Schroeren: Welche Herausforderungen gibt es trotz Vier-Tage-Woche noch bei der Dienstplanung und Personalbesetzung?
Henrik van Gellekom: Natürlich gibt es auch mit der Vier-Tage-Woche Situationen, in denen es auf Station nicht rundläuft – zum Beispiel durch viele Krankmeldungen. Wichtig ist, das klar zu trennen: Liegt es am Arbeitszeitmodell oder schlicht an einer Krankheitswelle, vielleicht auch an etwas ganz anderem? Solche Probleme können immer auftreten.
Dann wird es manchmal schwierig, alle Dienste zu besetzen. Deshalb haben wir zusätzlich den Flexpool, Einspringprämien und andere Modelle, um kurzfristig abzufedern. Im Extremfall müssen wir auch mal Betten sperren und die Patientenzahl reduzieren. Aber im Vergleich zu früher hat sich viel verbessert: Früher hatten wir auf den Stationen 25 Vollkräfte über Leasing, heute schaffen wir es mit unserem Team, fast alle Betten auch im Normalbetrieb selbst zu betreiben.
4-Tage-Woche in der Pflege – Erfahrung im Recruiting
Silvan Schroeren: Spüren Sie durch die Vier-Tage-Woche auch positive Effekte bei der Mitarbeitergewinnung?
Henrik van Gellekom: Auch wenn das Thema in meinem Alltag etwas zurückgetreten ist, bin ich sehr dankbar für dieses Modell. Immer wieder kommen Bewerber:innen und sagen: „Ihr seid doch die mit dem Vier-Tage-Woche-Modell – kann ich da drin arbeiten?“ Manchmal spreche ich es im Bewerbungsgespräch gar nicht mehr an, weil es für uns so selbstverständlich ist. Aber die Leute bringen es selbst ins Gespräch und das finde ich spannend und gut.

Zukunftsideen und neue Arbeitszeitmodelle
Silvan Schroeren: Gibt es neben der Vier-Tage-Woche schon neue Ideen oder Projekte, an denen Sie arbeiten?
Henrik van Gellekom: Für mich ist das gar keine Verrücktheit. Ich habe mir die Tarifsteigerungen sehr genau angeschaut. Da könnte man als Pflegekraft auch sagen: Ich nutze sie für einen Tag mehr frei. Das heißt, ich gehe auf 93,5 Prozent, arbeite viermal neun Stunden, also 36 Stunden pro Woche, und bekomme immer noch das gleiche Gehalt wie vor der Tarifsteigerung. Das ist auch Wohlstand, das ist auch Luxus, gerade in einem so herausfordernden Beruf.
Gemeinsam mit dem Team der Pflegedirektion versuche ich einfach, die Bedingungen so zu gestalten, dass Kolleginnen und Kollegen ihren tollen Job auch gut machen können. Und ja, es gibt weitere Ideen: Zum Beispiel einen völlig offenen Dienstplan, den Teams selbst schreiben. Jeder weiß, wer welche Stärken hat und wann er am besten einsetzbar ist – die einen lieber früh, die anderen eher spät oder länger bis in die Nacht. Andere sind besonders gut bei bestimmten Aufgaben, etwa beim Verbandswechsel am zweiten postoperativen Tag. Dann könnte man gezielt planen, dass genau diese Person in diesem Dienst da ist. Solche Ansätze gibt es schon in Pflegediensten, aber es wäre spannend, wenn Teams dadurch mehr Bewusstsein für ihren eigenen Dienst entwickeln und mehr Mitsprache hätten.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Durchlässigkeit zwischen Stationen. Heute ist es so, dass oft von außen entschieden wird: „Ihr müsst bitte auf der Nachbarstation unterstützen.“ Das sorgt schnell für ein Gefühl von Fremdbestimmung und Druck. Schöner wäre es, wenn Teams das selbst regeln könnten: Wenn drei Pflegekräfte morgens eingeteilt sind, aber nur zehn Patient:innen da sind, dann könnte jemand freiwillig sagen: „Ich helfe eine Stunde bei euch drüben aus.“ So wird niemand als „überflüssig“ abgestempelt, sondern die eigene Kompetenz wird wertgeschätzt. Dieses selbstbestimmte Unterstützen würde die Zusammenarbeit stärken und die Pflege insgesamt flexibler machen.
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Gehalt: Realistisch für die Pflege in Deutschland?
Silvan Schroeren: In anderen Ländern gab es bereits Studien zur Vier-Tage-Woche mit reduzierter Arbeitszeit bei vollem Gehalt. Die Ergebnisse zeigen positive Effekte auf Stresslevel, Lebensqualität und teilweise sogar auf die Produktivität. Wäre so ein Modell auch für die Pflege in Deutschland vorstellbar – oder würde uns das mit Blick auf den Fachkräftemangel überfordern?
Henrik van Gellekom: Ein Modell mit Arbeitszeitverkürzung bei vollem Gehalt würde für uns wahrscheinlich ein Nadelöhr schaffen, aus dem wir nicht herauskämen. Ich schätze unseren Tarif sehr, ob TVöD oder kirchliche Tarife wie BAT-KF oder AVR-DD. Da steckt schon viel drin: 38 Tage Urlaub, fast doppelt so viel wie das Arbeitszeitgesetz vorschreibt. Auch die Ausbildungsvergütung ist sehr attraktiv. Unsere Pflegeschüler:innen verdienen deutlich mehr als in vielen anderen Berufen.
Deshalb halte ich wenig davon, komplett aus den bestehenden Tarifen auszusteigen und ein eigenes Modell zu basteln. Das würde eine Schieflage erzeugen, gerade in einer Region wie Ostwestfalen-Lippe mit vielen großen Kliniken dicht beieinander. Wenn wir hier sagen würden: „Vollzeit bei 36 Stunden, volles Gehalt“, dann hätten wir sofort Konflikte mit den anderen Häusern. Unser Ziel ist aber, gemeinsam am Image des Pflegeberufs zu arbeiten und die Versorgung insgesamt besser zu machen.
Und zur Patientenseite: Die wenigsten wählen ein Krankenhaus wegen des Arbeitszeitmodells. Wer eine Hüfte braucht, geht dorthin, wo es nah ist oder wo jemand aus dem Umfeld gute Erfahrungen gemacht hat – nicht, weil dort eine Vier-Tage-Woche läuft.
Pflege neu denken: Warum „einfach machen“ oft der beste Weg ist
Silvan Schroeren: Zum Abschluss: Welchen Rat würden Sie anderen Arbeitgebern geben – nicht nur, wenn es um die Vier-Tage-Woche geht, sondern generell?
Henrik van Gellekom: Ich glaube, „einfach machen“ ist ein guter Leitsatz. Wenn man eine Idee hat, sollte man sie umsetzen, und wenn jemand anders eine gute Idee hat, ruhig hinschauen und auch kopieren. Natürlich haben andere Häuser gesagt: „Wir machen jetzt auch eine Vier-Tage-Woche.“ Aber manche sind falsch gestartet, etwa nur im Frühdienst oder mit einer zweiwöchigen Testphase. Das funktioniert nicht. Man braucht Konsequenz und Rückgrat, und vor allem Teams, die wirklich Lust darauf haben. Druck bringt nichts – es muss Begeisterung da sein.
Wichtig ist auch, über den Tellerrand zu schauen. In Dortmund etwa gibt es Modelle mit zusätzlichem Urlaub. Es lohnt sich, auf Kongressen ins Gespräch zu gehen oder einfach Kontakt aufzunehmen – die Daten sind ja öffentlich. Wir wurden schon von Passau bis Bremen angefragt. In Bremen hat mich sogar die Bürgermeisterin eingeladen, um von unseren Erfahrungen zu berichten.
Mein Fazit: Einfach machen, sich Mitstreiter suchen, gemeinsam etwas Neues ausprobieren. Dann entstehen Projekte, die nicht nur gut funktionieren, sondern auch Spaß machen.
Das komplette Gespräch ansehen:
Das gesamte Interview mit Henrik van Gellekom zur 4-Tage-Woche in der Pflege finden Sie auch auf YouTube.



%20aktuell.png?width=300&height=300&name=Podcast%20Cover%20(Close%20Up)%20aktuell.png)