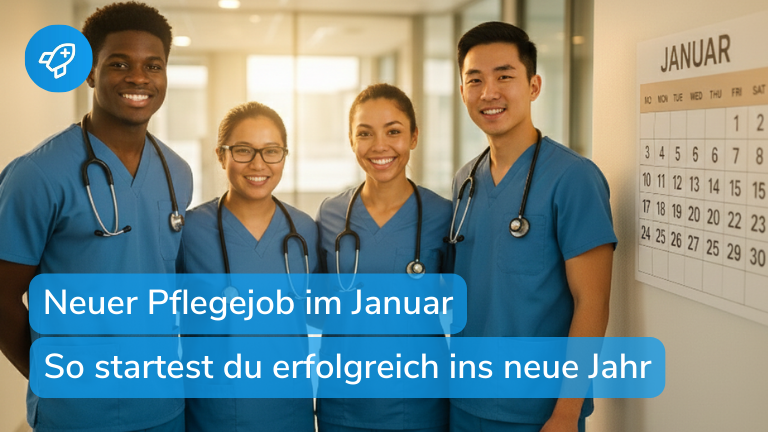Was bedeutet Gewalt in der Pflege? Definition & Einordnung
Um Gewalt im Pflegekontext zu erkennen, reagieren zu können oder im besten Fall zu vermeiden, ist es wichtig, zu wissen: Wobei handelt es sich überhaupt alles um Gewalt?
Der Spitzenverband der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) definiert Gewalt in „Begriffe zum Thema Gewalt“ 2016 wie folgt:
„Gewalt wird meistens als eine schädigende Einwirkung auf Andere verstanden. Gewalt kann psychische oder physische, statische oder dynamische sowie direkte oder indirekte Formen annehmen.
Ein engerer Gewaltbegriff, auch als „materialistische Gewalt“ bezeichnet, beschränkt sich auf die zielgerichtete, direkte physische Schädigung einer Person.
Der weiter gefasste Gewaltbegriff bezeichnet zusätzlich die psychische Gewalt z. B. in Form von verbaler Gewalt, Deprivation und emotionaler Vernachlässigung.“
Welche Formen von Gewalt in der Pflege gibt es?
Die Definition der DGUV zeigt: Gewalt in der Pflege kann also viele Formen annehmen:
Physische Gewalt in der Pflege
Dies beinhaltet Handlungen, die zu körperlichen Verletzungen führen. Beispiele hierfür können sein:
- Schlagen, Stoßen, Kratzen, Schütteln oder absichtlich zu grob anfassen
- freiheitsentziehende Maßnahmen oder Einschränkung der Bewegungsfreiheit (z. B. durch Vorenthalten eines Rollstuhls oder Rollators)
- Verweigerung von notwendiger physischer Hilfe, zum Beispiel beim Aufstehen, Gehen oder bei der Körperpflege.
- Medikamente verabreichen, die nicht verordnet sind, um die pflegebedürftige Person ruhigzustellen
- zum Essen zwingen oder keine Schluckpausen lassen
Psychische Gewalt im Pflegealltag
Psychische Gewalt ist weniger offensichtlich und von außen nicht immer leicht zu erkennen. Beispiele hierfür sind:
- religiöse oder kulturelle Gebote missachten
- die pflegebedürftige Person erniedrigen, beleidigen oder über den Kopf hinweg sprechen
- Einschüchterungen und Drohungen
- soziale Kontakte vorenthalten oder erzwingen
- geäußerte Wünsche und Bedürfnisse ignorieren oder bagatellisieren
Sexualisierte Gewalt in Pflegeeinrichtungen
Dieser Form der Gewalt ereignet sich häufig im Verborgenen, da die Betroffenen aus Scham oft schweigen. Beispiele sind:
- Verletzung der Intimsphäre, z. B. unnötig langes Entblößen
- sexuelle Handlungen ohne Zustimmung
- Unerwünschte sexuelle Kommentare oder Anspielungen
- Druckausübung oder Erzwingen sexueller Aktivitäten
Finanzielle Gewalt gegenüber Pflegebedürftigen
Finanzielle Gewalt fängt schon damit an, unerlaubt Kontoauszüge einzusehen, hin zu schwerem Diebstahl. Beispiel für diese Form von Gewalt sind:
- Diebstahl von Geld oder Eigentum
- Pflegebedürftige zu Geschenken oder Vollmachten überreden
- Geschenke oder Geld vorenthalten
Kulturelle Gewalt im Pflegekontext
Kulturelle Gewalt entsteht, wenn Pflegekräfte oder Pflegebedürftige aufgrund kultureller Unterschiede respektlos, ausgrenzend oder abwertend behandelt werden – oft unbeabsichtigt, aber mit ernster Wirkung.
Typische Beispiele:
-
Eine Pflegekraft spricht absichtlich nur Deutsch, obwohl der Pflegebedürftige eine andere Muttersprache hat – obwohl einfache Übersetzungshilfen möglich wären.
-
Kulturelle Rituale werden nicht respektiert
-
Speisen, die religiös oder kulturell nicht akzeptiert sind, werden ohne Rücksicht angeboten – z. B. Schweinefleisch trotz bekannten Verbots.
-
Traditionelle Kleidung oder Kopfbedeckungen werden ohne Absprache entfernt.
→ Mehr zum Thema: Kultursensible Pflege
Vernachlässigung als stille Form der Gewalt
Gewalt kann auch stattfinden, indem etwas nicht getan wird, oder wenn der Schaden einer Person nicht offensichtlich oder mittelbar eintritt, aber billigend in Kauf genommen wird.
- nicht aufs Klingeln reagieren, lange auf Hilfe warten lassen
- emotionale Bedürfnisse ignorieren
- Grundversorgung vernachlässigen oder vorenthalten
- nicht ausreichend auf Sicherheit (z. B. beim Duschen oder Treppensteigen achten)
- mangelhafte Wundversorgung oder Hygiene
Konkrete Fallbeispiele: Gewalt in der Pflege erkennen
Ein Beispiel, das jeder Pflegeperson in der ein oder anderen Form bereits begegnet sein dürfte: Eine pflegebedürftige Person nutzt den Patientennotruf (die Klingel) in ausnehmend hoher Frequenz und klingelt alle 10 Minuten für scheinbar belanglose Wünsche oder auch nur „aus Versehen“.
Hier drei Beispiele für mögliche (sowie unangemessene) Reaktionen, die bereits als Gewalt zu beurteilen sind:
- Die pflegebedürftige Person „erziehen“ wollen, indem man als zuständige Pflegeperson nicht direkt reagiert.
- Den Auslöser für den Patientennotruf außer Reichweite legen oder den Stecker ziehen.
- Die Klingel von einer zentralen Bedienstelle aus ausschalten und ignorieren.
Dieses Beispiel verdeutlicht auch, wie alltäglich Gewalt in der Pflege sein kann.
An wen richtet sich Gewalt in der Pflege?
Gewalt gegen Pflegebedürftige: Formen und Machtmissbrauch
Pflegebedürftige Menschen sind auf die Hilfe anderer angewiesen. Sie haben oft keine andere Wahl, als den Pflegenden zu vertrauen, dass diese ihren Aufgaben verantwortungsvoll nachkommen.
Besonders problematisch ist das, wenn Betroffene kognitiv eingeschränkt sind, etwa durch eine Demenz. In solchen Fällen fehlt ihnen häufig die Fähigkeit, Gewalthandlungen zu benennen oder sich zu wehren.
Pflegekräfte tragen damit eine große Verantwortung – und auch Macht. Dieses Machtgefälle ist Teil des Pflegealltags, macht ihn aber gleichzeitig so sensibel. Es verlangt von allen Beteiligten höchste Achtsamkeit.
Leider habe ich immer wieder erlebt, wie ebendieses Machtgefälle zu Situationen der Gewalt gegenüber Pflegebedürftigen geführt hat. Dabei handelte es sich nicht immer um willentlichen Machtmissbrauch, in vielen Fällen führte die schiere Überlastung meiner Kolleg:innen zu jenen gewalttätigen Handlungen.
Damit möchte ich dieses Verhalten nicht entschuldigen. Ich möchte es aber gegenüber der Gewalt abgrenzen, die mutwillig stattfindet: Mir sind in der Pflege bisweilen Menschen begegnet, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie diesen Beruf nur gewählt haben, weil sie dadurch diese Macht über andere, hilflose Menschen erlangten. Je nach Grad der Subtilität ihres Verhaltens ist es für andere Kolleg:innen häufig schwer, diese Form von Gewaltausübung zu erkennen.
Besonders kritisch wird es, wenn Pflege außerhalb des Teams geschieht, etwa im ambulanten Bereich, wo soziale Kontrolle fehlt. Hier ist das Risiko verdeckter Gewalt besonders hoch.
In seltenen, aber erschütternden Fällen kommt es sogar zu offener körperlicher Gewalt – hin zu sogenannten „Todesengeln“. Die Motive für ein solches Verhalten reichen hierbei vom Frust durch Überforderung bis zu einer psychischen Erkrankung der Pflegeperson.
Gewalt gegen Pflegekräfte
Gewalt gegen Pflegende geschieht oft verdeckt und wird häufig bagatellisiert. Sei es das „versehentliche“ Grabschen einer zu pflegenden Person bei der Grundpflege, verbale Aggressivität psychisch kranker Pflegebedürftiger oder physische Gewalt wie schlagen, beißen, treten oder kratzen.

Meiner Erfahrung nach nehmen viele Pflegende solche Grenzüberschreitungen bis zu einem gewissen Grad einfach als gegeben hin: Die Pflegebedürftigen seien krank, sie wüssten nicht, was sie da tun, das gehöre nun mal zum Beruf dazu.
Letzteres mag zutreffen. Dennoch ist es aus meiner Sicht wichtig, dieses Verhalten nicht einfach hinzunehmen, sondern zumindest mit anderen Personen, vielleicht mit Freund:innen, vielleicht auch im Kollegium, darüber zu reden.
Nicht selten überschreitet die Gewalt gegenüber Pflegenden aber auch die Grenze des Hinnehmbaren. Der schwerste Fall in meiner Laufbahn war der Angriff auf eine Kollegin während einer Nachtschicht. Ein Patient, der sich zuvor unauffällig verhalten hatte, schlug ihr mit einer Glasflasche auf den Kopf. Sie konnte von Glück reden mit dem Leben davongekommen zu sein.
Gewalt zwischen Pflegebedürftigen
Oft richtet sich Gewalt nicht nur gegen Pflegende, sondern auch unter Pflegebedürftigen. Derselbe Patient, der meiner Kollegin damals so übel mitgespielt hat, hatte wenige Minuten zuvor seinem Zimmernachbarn, einem älteren Herrn, der nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt war, mit derselben Glasflasche mehrfach ins Gesicht geschlagen. Besonders grausam erscheint diese Tat vor dem Hintergrund, dass sich besagter Zimmernachbar wirklich in keiner Form zur Wehr setzen konnte.
Der Täter in diesem Beispiel war aber nun kein boshafter, hinterlistiger oder von Natur aus gewalttätiger Mensch: Er unterlag zum gegebenen Zeitpunkt schlichtweg einer psychischen Entgleisung und war nicht Herr seiner Sinne in jener Nacht. Sein Motiv für die Ausübung der Gewalt: Angst vor der eigenen Erfahrung von Gewalt.
Besonders in der stationären Langzeitpflege kommt es aber auch immer wieder zu anderen, mal mehr und mal weniger direkten Formen der Gewalt. Vor dem Hintergrund einer demenziellen Erkrankung finden beispielsweise immer wieder Grenzüberschreitungen statt, die von anderen Personen nicht toleriert bzw. verstanden werden und auf aggressives Verhalten stoßen. Aggressives Verhalten kann aber auch aus einer demenziellen Erkrankung resultieren.
Ebenso finden auch in stationären Pflegeeinrichtungen Formen der Gewalt statt, die auch in anderen Formen des sozialen Zusammenlebens zu beobachten sind: Ausgrenzung, Gruppenbildung, Mobbing, sexuelle Belästigung bzw. Übergriffigkeit.
Kommt es zur Gewalt zwischen Pflegebedürftigen, sind häufig Pflegekräfte gefragt, zu intervenieren. Dies kann heißen, dass man akut in Gewalthandlungen eingreifen muss oder auch durch Maßnahmen weiteren Gewalthandlungen vorbeugen kann.

Eine Sensibilität für das Thema „Gewaltfreie Pflege“ kann helfen, generellen Kontexten vorzubeugen, in denen es zur Gewalt kommen kann. Dazu gehört ein umfassendes Verständnis der Bedürfnisse und Gewohnheiten der zu pflegenden Personen sowie eine an diesen Bedürfnissen orientierte und im machbaren Grade individualisierte Gestaltung des Tagesablaufs.
Studien & Zahlen: Wie häufig kommt Gewalt in der Pflege vor?
Gewalt in der Pflege ist nicht immer offensichtlich. Sie statistisch zu erfassen, ist schwierig. Aufgrund der hohen Privatheit von Pflegehandlungen bleibt zu vermuten, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt.

Hier einige Zahlen (Quelle DGUV Forum 3/2023, Stiftung ZQP „Häufigkeit von Gewalt in der Pflege", ZQP Report „Gewaltprävention in der Pflege“):
- Verbale Gewalt gegen Pflegekräfte: In einer Studie in Pflegeheimen in Nordrhein-Westfalen berichteten 69 % der über 1.300 befragten Mitarbeitenden von Gewalterfahrungen durch Bewohner in den vergangenen vier Wochen, primär verbale Angriffe (63 %), körperliche Gewalt (38 %) und sexuell übergriffiges Verhalten (14 %).
- Psychische Belastung: 68 % aller Betroffenen fühlten sich nach Gewaltereignissen belastet, und etwa ein Drittel der Befragten, die Aggressionen ausgesetzt waren, fühlten sich psychisch erheblich belastet.
- Problematisches Verhalten von Pflegekräften: In einer Befragung von Mitarbeitern ambulanter Pflegedienste berichteten etwa 39,7 % von mindestens einer Form eigenen problematischen Verhaltens gegenüber Pflegebedürftigen im Zeitraum der letzten zwölf Monate. Davon waren 21,4 % verbale Aggression und psychische Misshandlung, 18,8 % pflegerische Vernachlässigung, und 8,5 % physische Gewalt.
- Aggressives Handeln unter Bewohner:innen: In einer Studie berichteten 69 % der Befragten aus 73 Pflege-Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen von verbalen Aggressionen zwischen Pflegebedürftigen in den vergangenen vier Wochen. 33 % beobachteten körperliche Gewalt und 10 % sexuell übergriffiges Verhalten.
Wie erkenne ich gewalttätiges Verhalten im Pflegekontext?
Wie die Beispiele oben bereits gezeigt haben, ist es manchmal nicht leicht, Gewalt in der Pflege als solche zu identifizieren, manch anderes Mal ist es sehr offensichtlich.
Es ist bereits hilfreich, dass du dich gerade mit den unterschiedlichen Formen der Gewalt in der Pflege vertraut machst, um diese besser erkennen zu können. Denn egal, um welche Form der Gewalt es geht, es ist immer falsch, sie zu ignorieren oder die Augen vor ihr zu verschließen.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema schafft dabei eine Sensibilisierung, die es einem leichter macht, entsprechendes Verhalten frühzeitig zu erkennen, ohne mit ständigem Misstrauen durch die Welt zu gehen.
Eigenes Verhalten reflektieren und Verantwortung übernehmen
Ebenso sollten Menschen, die sich für den Pflegeberuf entscheiden, stets offen dafür sein, sich selbst und ihr eigenes Verhalten kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren. Der Beruf geht nun mal mit einem hohen Maß an physischer und psychischer Belastung einher und wir alle sind nicht davor gefeit, auch mal an die Grenzen unserer eigenen Belastbarkeit zu geraten.
Zeichnet sich eine solche Situation ab, ist es wichtig, dass man rechtzeitig auf die Überbelastung aufmerksam macht. Hier hilft es, wenn man das Gespräch zu seiner Führungskraft sucht, oder bei entsprechender Schwere der Belastung bei seinem Arbeitgeber eine Überlastungsanzeige stellt, bevor andere Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden.
Krankenbeobachtung: Warnzeichen richtig deuten
Die Beobachtung der Pflegebedürftigen über die Betreuungszeit hinweg ist ebenso wichtig. Fallen dir als Pflegeperson bei einem Pflegebedürftigen Anzeichen auf, die auf eine physische oder auch psychische Gewalteinwirkung hindeuten.
Hier einige Beispiele für solche Anzeichen:
- plötzliche Ängstlichkeit, Zurückgezogenheit oder Schreckhaftigkeit.
- Wunden, Hämatome, Kratzer oder andere Verletzungen.
- mangelnde Hygiene kann ebenfalls ein Zeichen für Gewalt durch Vernachlässigung/Missachtung sein.
- Abdrücke auf der Haut, die auf eine unrechtmäßige Fixierung (Freiheitsentziehende Maßnahmen) hindeuten.
- Gewichtsverlust, trockene Schleimhäute, verringerter Hautturgor als Folge von Mangelernährung und Dehydration.
Ursachen von Gewalt in der Pflege: Überforderung, Strukturen & Macht
Pflege kann anstrengend sein und das nicht nur beruflich Pflegende, sondern auch für Angehörigen und die Pflegebedürftigen selbst. Die Ursachen von Gewalt in der Pflege können vielfältig sein:

- Unwissenheit: Manche Menschen wissen nicht, dass sie Gewalt praktizieren, weil sie nicht entsprechend sensibilisiert sind
- Überlastung: Lange Arbeitszeiten, eine hohe Arbeitsbelastung und Zeitdruck können zu Stress und Überforderung führen. Wenn Pflegende dann noch ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse ignorieren, kann dies in gewalttätigem Verhalten resultieren.
- Psychische Erkrankungen der Pflegebedürftigen: Bestimmte Erkrankungen, wie Demenz oder psychische Störungen, können bei Pflegebedürftigen zu aggressivem Verhalten führen.
- Unzureichende Ausbildung und Schulung: Fehlendes Training im Umgang mit schwierigen Situationen oder in der Kommunikation kann zu Missverständnissen und Konflikten führen.
- Persönliche Probleme des Pflegepersonals: Private Stressfaktoren, wie familiäre Probleme oder finanzielle Sorgen, können sich auf die Arbeit auswirken. Auch pflegende Angehörige befinden sich oftmals in einer persönlichen Ausnahmesituation, auf die die wenigsten vorbereitet sind.
- Kulturelle und sprachliche Barrieren: Unterschiede in Sprache und Kultur zwischen Pflegepersonal und Pflegebedürftigen können zu Missverständnissen und Konflikten führen.
- Fehlende Präventionsmaßnahmen und Richtlinien: Das Fehlen klarer Richtlinien und Präventionsstrategien gegen Gewalt in Pflegeeinrichtungen kann das Risiko für gewalttätige Vorfälle erhöhen.
-
Abwehrreaktion auf unsensibles Verhalten: Oft ist Gewalt auch eine Reaktion auf unwirsches oder unhöfliches Verhalten des Gegenübers. Etwa, wenn die Pflegekraft ohne Vorwarnung Spritzen verabreicht oder die pflegebedürftige Person sich im Ton vergreift.
Welche Folgen hat Gewalt in der Pflege?
Bei Betroffenen von Gewalt kann es unter anderem zu diesen Folgen kommen:
- Psychische und emotionale Traumata: Auf Seiten der Pflegebedürftigen können sich Krankheitsbilder vertiefen, insbesondere bei psychischen Erkrankungen. Bei Pflegepersonal kann eine Konfrontation mit Gewalt im Arbeitskontext ebenfalls langfristige Konsequenzen bis hin zur Berufsunfähigkeit nach sich ziehen.
- Physische Verletzungen: Gewalt kann zu körperlichen Verletzungen bei Pflegebedürftigen und Pflegepersonal führen, die von leichten Verletzungen hin zu schweren Schäden reichen können.
- Vertrauensverlust: Gewalt untergräbt das Vertrauen zwischen Pflegebedürftigen und Pflegepersonal. Dies kann die Qualität der Pflege und die Beziehung zwischen den Beteiligten beeinträchtigen.
-
Verschlechterung des Gesundheitszustandes: Durch das Abhängigkeitsverhältnis, in dem sich Pflegebedürftige naturgemäß befinden, können sie das Gefühl bekommen, ausgeliefert zu sein. Dies kann dazu führen, dass sich der Gesundheitszustand verschlechtert, Pflegebedürftige sich sozial isolieren oder Behandlungen verweigert werden.
-
Arbeitsunzufriedenheit: Für Pflegekräfte kann die Erfahrung oder das Beobachten von Gewalt zu Arbeitsunzufriedenheit, Burnout und sogar zum Verlassen des Berufsfeldes führen.
-
Negative Auswirkungen auf die Einrichtung: Gewalt in Pflegeeinrichtungen kann deren Ruf schädigen, zu rechtlichen Konsequenzen führen und die Mitarbeiterfluktuation erhöhen.
Wie verhalte ich mich, wenn ich Zeug:in oder Opfer von Gewalt in der Pflege werde?
Vertrauen spielt eine große Rolle bei der Arbeit in der Pflege. Sowohl gegenseitiges Vertrauen in einem Pflegeteam, als auch das Vertrauen der Pflegebedürftigen gegenüber Pflegenden und umgekehrt. Und ebenso wichtig ist es in der stationären Langzeitpflege, dass sich die Bewohner:innen dort in einem vertrauenswürdigen Umfeld bewegen können. Dieses Umfeld stellt ja nun mal ihr Zuhause dar.
Gewalt erkennen und ansprechen
Wenn du Anzeichen von Gewalt wahrnimmst – ob körperlich, psychisch oder strukturell –, sprich die betroffene Person behutsam an. Hinterfrage die Situation und biete Hilfe an. Oft reicht schon ein offenes Gespräch, um eine belastende Lage zu klären oder einzugreifen.
Vorgesetzte einbeziehen
Je nach Situation solltest du auch Führungskräfte informieren oder das Verhalten offiziell melden. Ja, das kann schwerfallen – besonders wenn es Kolleg:innen betrifft. Doch: Schweigen schützt Täter:innen, nicht Opfer. Du schützt damit Menschen, die sich oft nicht selbst wehren können.
Bedenke immer, dass es im Pflegeberuf am Ende des Tages darum geht, die uns zur Fürsorge anvertrauten Personen zu schützen und zu unterstützen, wo sie es selbst nicht mehr können.
Manchmal kann es auch hilfreich sein, wenn du dir bei einer dritten Person Rat suchst, der du vertraust, wenn du nicht weißt, wie du dich in einer Situation richtig verhalten sollst.
Beratungsstellen bei Gewalt in der Pflege
Darüber hinaus gibt es verschiedene Beratungsangebote, die sich teilweise sogar ganz gezielt dem Thema Gewalt in der Pflege widmen und an alle möglichen Beteiligten richten.
Ein Beispiel für ein solches Angebot ist die Beratungsstelle „Pflege in Not“ der Diakonie-Mitte in Berlin.
Wie kann ich Gewalt in der Pflege vorbeugen?
Durch eine Sensibilisierung für die Thematik rund um Gewalt in der Pflege und mögliche Erscheinungsformen kannst du gewalttätiges oder aggressives Verhalten frühzeitig erkennen oder auch im Moment des Auftretens unterbinden.
Sei achtsam für deine Mitmenschen, seien es Kolleg:innen oder Pflegebedürftige, Angehörige oder anderes medizinisches Personal in deinem Arbeitsumfeld. Durch diese Achtsamkeit können wir oft frühzeitig Anzeichen für drohende Gefährdungen erkennen und andere davor schützen, zu verletzen oder verletzt zu werden.
Ein guter Anfang für vorbeugendes Verhalten liegt aber immer ganz nahe: bei dir selbst. Durch ausreichende Selbstfürsorge (z. B. Sport als Ausgleich zum Beruf, andere gesundheitsfördernde Maßnahmen) kannst du dafür sorgen, dass du selbst nicht an deine Belastungsgrenze gerätst und dich im Arbeitsalltag unter Kontrolle hast.
Noch mal: Es ist nicht schlimm, auch sein eigenes Verhalten kritisch zu hinterfragen oder sich einzugestehen, dass man für sich eine Belastungsgrenze erreicht hat. Diese Selbstreflektiertheit kann auch andere schützen.
Besseren Job in der Pflege finden mit Care Rockets
Solltest du das Gefühl haben, dass dein derzeitiger Job dich einer so starken Belastung aussetzt, dass auch die oben erwähnten Maßnahmen dir keine Aussicht auf ein erfülltes Arbeitsleben bieten, kann auch ein Arbeitgeberwechsel eine sinnvolle Option für dich sein.
Wir von Care Rockets setzen uns für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege ein. Auf Care Rockets findest du über 2.200 Arbeitgeber, die sich bei dir bewerben.
.jpg)




%20aktuell.png?width=300&height=300&name=Podcast%20Cover%20(Close%20Up)%20aktuell.png)