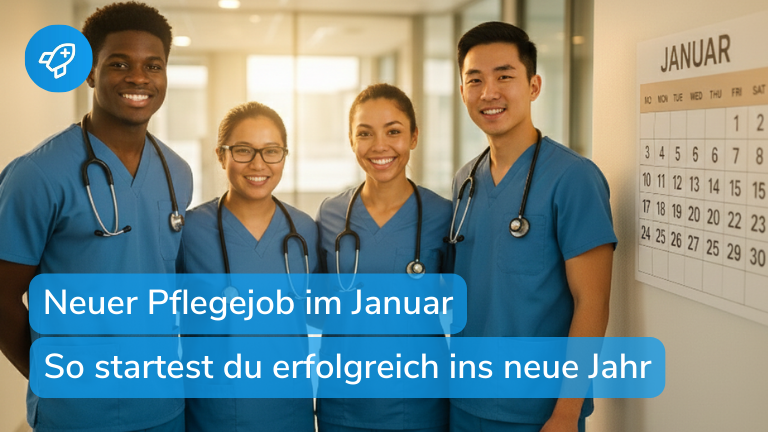Was ist kultursensible Pflege? – Definition, Bedeutung und Zielsetzung
Kultursensible Pflege bedeutet, Menschen so zu pflegen, dass ihre kulturellen und religiösen Bedürfnisse respektiert werden. Sie geht über Gleichbehandlung hinaus und fragt: Was brauchst du, damit du dich sicher und respektiert fühlst?
Kultursensibel pflegen heißt vielmehr, die persönlichen Werte, Gewohnheiten und Glaubensrichtungen der Pflegebedürftigen zu respektieren und in die Versorgung zu integrieren
Rechtliche Grundlagen zur kultursensiblen Pflege
Kultursensible Pflege ist kein Nice-to-have, sondern Pflicht. Laut § 1 Abs. 5 SGB XI müssen Pflegeeinrichtungen kulturelle und geschlechtsspezifische Besonderheiten berücksichtigen.
Auch die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen sichert in Artikel 7 das Recht zu, entsprechend der eigenen Religion, Kultur und Weltanschauung zu leben und dabei Unterstützung zu erhalten.
Ethisch ist die Sache klar: Der ICN-Ethikkodex fordert, alle Menschen mit Respekt und ohne Vorurteile zu behandeln, egal welche Herkunft, Kultur oder Religion sie haben. Pflegefachpersonen sind gefordert, sich ihrer eigenen kulturellen Prägungen bewusst zu sein und Diskriminierung aktiv entgegenzutreten.

Warum ist kultursensible Pflege wichtig?
Gerade in der Altenpflege treffen Pflegekräfte immer öfter auf Menschen mit Migrationsgeschichte. Aktuell macht ihr Anteil etwa 9 % aus – Tendenz steigend (BAMF) Viele von ihnen haben andere Vorstellungen von Krankheit, Familie oder Körperpflege. Wenn du diese Vorstellungen ernst nimmst, kannst du viel Stress und Missverständnisse vermeiden.
Pflege funktioniert nur dann gut, wenn Vertrauen da ist. Und Vertrauen entsteht, wenn sich Menschen verstanden fühlen. Wer kulturelle Werte ignoriert, riskiert genau das Gegenteil: Ablehnung, Konflikte oder Rückzug. Du arbeitest also nicht „mehr“, wenn du kultursensibel pflegst, sondern du arbeitest effektiver.
Ziele kultursensibler Pflege
Kultursensible Pflege verfolgt klare Ziele. Sie stärkt nicht nur die Beziehung zu den Pflegebedürftigen, sondern verbessert auch die gesamte Versorgung.
- Du baust Vertrauen auf und stärkst die Beziehung.
- Du ermöglichst selbstbestimmte Entscheidungen.
- Du senkst Barrieren beim Zugang zur Pflege.
- Du stärkst die Teilhabe – unabhängig von Herkunft oder Religion.
- Du verbesserst die Pflegequalität.
Transkulturelle und interkulturelle Pflege – Unterschiede & Praxis
Im Alltag musst du nicht zwischen den Begriffen unterscheiden, aber du solltest wissen, was sie bedeuten.
- Interkulturelle Pflege: Du reagierst sensibel auf kulturelle Unterschiede – zum Beispiel bei Sprache, Essen oder Intimpflege. Der Fokus liegt auf der Begegnung zwischen Kulturen und der Bereitschaft, Unterschiede zu akzeptieren.
- Transkulturelle Pflege (z. B. nach Leininger): Du planst Pflege systematisch so, dass kulturelle Aspekte fester Teil deiner Arbeit werden. Das beginnt bei der Anamnese und endet nicht beim Speiseplan. Es geht um konkrete Strukturen, Modelle und Konzepte, die kulturelle Vielfalt aktiv einbeziehen.
-
Kultursensible Pflege:
Du gehst offen, respektvoll und reflektiert auf individuelle Unterschiede ein. Dabei berücksichtigst du nicht nur Kultur, sondern auch Religion, Identität, Biografie oder Diskriminierungserfahrungen. Es geht weniger um Kategorien und mehr um Haltung: Du siehst den Menschen in seiner Vielfalt und richtest deine Pflege daran aus.
Warum nutzen viele Menschen mit Migrationshintergrund Pflegeangebote nicht?
Viele Menschen mit Migrationshintergrund nehmen Pflegeangebote seltener in Anspruch – nicht, weil sie keine Hilfe brauchen, sondern weil sie Hürden erleben, die andere nicht haben.
Diese Barrieren spielen eine große Rolle:
- Sprache: Wer Informationen nicht versteht, kann Angebote nicht nutzen. Viele ältere Migrant:innen sprechen kaum oder kein Deutsch.
- Vertrauen: Negative Erfahrungen mit Behörden oder Angst vor Diskriminierung halten viele zurück.
- Kulturelle Unterschiede: Wenn Pflege nicht zu den eigenen Werten passt, wird sie oft abgelehnt, z. B. bei Essen, Intimpflege oder Umgang mit Krankheit.
Die Folgen: Pflegebedürftige werden zu spät oder gar nicht versorgt. Familien müssen mehr leisten, als sie können. Und die Teilhabe am Gesundheitssystem bleibt ungleich verteilt. Kultursensible Pflege kann hier konkret helfen, indem sie Brücken baut und Zugänge erleichtert.
.webp?width=825&height=550&name=alter-mensch-umarmung%20(1).webp)
Welche Kompetenzen braucht kultursensible Pflege?
Kultursensible Pflege beginnt nicht beim Patienten, sondern bei dir. Du brauchst nicht nur fachliches Wissen, sondern auch Haltung, Offenheit und Kommunikationsstärke.
Diese Kompetenzen sind entscheidend:
- Fachlich: Du kennst kulturelle Unterschiede in Pflegegewohnheiten, Ernährung, Religion und Kommunikation – und kannst dein Handeln daran anpassen.
- Sozial: Du begegnest Menschen mit Respekt, Geduld und Interesse – auch wenn dir etwas fremd erscheint.
- Kommunikativ: Du hörst aktiv zu, stellst offene Fragen und suchst nach Wegen, auch ohne gemeinsame Sprache zu verstehen.
Genauso wichtig: Selbstreflexion im Team. Du hinterfragst deine eigenen Werte, Normen und Reaktionen. Im Austausch mit dem Team lernst du, Vorurteile zu erkennen und gezielt abzubauen. So wächst nicht nur deine Kompetenz, sondern die Qualität der Pflege im ganzen Team.
Kultursensible Pflege bei LGBTQ+-Personen: Was gilt es zu beachten?
Auch sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität gehören zur kulturellen Vielfalt. Traditionell lag der Fokus kultursensibler Pflege oft auf Herkunft oder Religion. Themen wie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sind bislang kaum im Curriculum der Pflegeausbildungen verankert.
Doch immer mehr Expert:innen fordern, den Kulturbegriff zu erweitern oder durch einen Diversity-Ansatz zu ergänzen, um auch LGBTQ+-Personen (lesbische, schwule, bi+, trans, inter* und queere Menschen) mitzudenken (lsvd.de).
Viele LGBTQ+-Personen haben in ihrem Leben Ausgrenzung, Diskriminierung oder sogar Gewalt erlebt. Diese Erfahrungen bringen sie oft mit in die Pflegebeziehung.
Das solltest du beachten:
- Lebensrealität und Biografie: Manche ältere LGBTQ+-Personen haben ihre Identität jahrelang versteckt. Offenheit braucht Vertrauen.
- Diskriminierung im Gesundheitssystem: Viele vermeiden Pflegeangebote aus Angst vor Ablehnung oder schlechten Erfahrungen.
- Kommunikation: Sprich respektvoll, stelle keine übergriffigen Fragen, nutze inklusive Sprache. Wenn du unsicher bist, frag höflich nach dem gewünschten Namen oder Pronomen.
- Geschützte Räume: Sorge für ein Umfeld, in dem sich Menschen sicher fühlen, frei von Bewertungen, Klischees oder Abwertung.
Kultursensible Pflege heißt hier: Du begegnest Menschen so, wie sie sind, ohne zu urteilen, aber mit dem Willen, ihre Identität anzuerkennen und zu respektieren.
Mehr dazu bald in einem eigenen Blogbeitrag über LGBTQ+ in der Pflege.
Wie lässt sich kultursensible Pflege im Alltag umsetzen?
Kultursensibel pflegen heißt: Du stellst die individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt und nicht deine Routinen. Das klingt einfach, ist im Pflegealltag aber oft herausfordernd. Zeitdruck, Sprachbarrieren oder Unsicherheit im Umgang mit fremden Kulturen erschweren es, kultursensibel zu handeln.
Hier ein paar konkrete Beispiele und Hilfen, wie du als Pflegekraft auf kulturelle Bedürfnisse eingehen können:
Eigene Kultur und Werte reflektieren
Der erste Schritt ist, sich der eigenen kulturellen Prägungen bewusst zu werden. Jede:r bringt unbewusste Bilder und Annahmen über andere Kulturen mit. Pflegende sollten diese Selbstreflexion aktiv betreiben und sich fragen, welche Vorurteile oder Annahmen sie möglicherweise beeinflussen (pflegenetzwerk-deutschland.de).
Eine wertschätzende Grundhaltung zeigen
Begegne Pflegebedürftigen stets mit einer grundsätzlichen Offenheit für verschiedene Lebensstile, Religionen und Gewohnheiten. Signalisiert eine pflegebedürftige Person etwa ein ungewohntes Bedürfnis (z. B. nachts zu beten, bestimmtes Essen), reagiere mit Interesse statt Abwehr. Hör und erkunde dich nach den Hintergründe. Meist steckt ein wichtiger Wert oder ein Bedürfnis dahinter.
Individuelle Pflegeplanung
Weg mit der Schablonenpflege. Kultursensible Pflege beginnt bei dir. Nutze Biografiearbeit oder das Aufnahmegespräch, um herauszufinden, was deinem Gegenüber im Alltag wichtig ist.
Frag nach: Gibt es Rituale, Essensregeln oder Gebete, die du berücksichtigen solltest? Halte solche Infos im Pflegeplan fest – und gib sie im Team weiter. So wissen alle Bescheid.
Schau dabei auch auf deine Routinen: Muss die Körperpflege wirklich morgens früh sein, wenn jemand vorher beten möchte? Vielleicht geht es auch später. Kultursensible Pflege heißt, offen und flexibel zu bleiben – und dich immer wieder neu auf die Person einzulassen.
Kommunikation und Beziehungsgestaltung
Die Kommunikation gehört zu den größten Herausforderungen in der kultursensiblen Pflege. Vielen älteren Migrant:innen fehlen ausreichende Deutschkenntnisse, um sich über gesundheitliche Belange differenziert auszudrücken. Bei Demenz geht die Zweitsprache oft ganz verloren.
Verständigungsprobleme führen dazu, dass Pflegeangebote nicht verstanden oder abgelehnt werden. Viele haben Angst vor Missverständnissen oder haben schlechte Erfahrungen gemacht. Das schwächt das Vertrauen.
Dazu kommt: Kommunikation ist nicht nur Sprache. Nonverbale Signale wie Gestik oder Blickkontakt haben je nach Kultur ganz unterschiedliche Bedeutungen. Beispiel: In Bulgarien bedeutet Kopfschütteln „Ja“, in Japan kann ein Winken "Nein" meinen.
Was hilft? Sprich einfach, klar und offen. Frag nach, statt zu raten. Nutze Dolmetscher, zweisprachige Kolleg:innen, Bilder oder Übersetzungs-Apps. Achte auf Mimik, Distanzverhalten und Blickkontakt.
Tipp: Schon ein einfaches „Guten Tag“ in der Muttersprache kann Vertrauen schaffen und Gespräche erleichtern.
Berücksichtigung von Ernährung, Ritualen, Pflegegewohnheiten
Viele kulturelle Unterschiede zeigen sich im Kleinen: beim Essen, bei der Körperpflege oder im Umgang mit Nähe. In der kultursensiblen Pflege achtest du genau darauf:
- Ernährung: Religiöse Verbote (z. B. kein Schweinefleisch im Islam), Essgewohnheiten (z. B. warme Mahlzeiten morgens) oder spezielle Rituale (Fastenzeiten) solltest du kennen und respektieren.
- Pflegegewohnheiten: Manche Menschen möchten sich z. B. nur von gleichgeschlechtlichen Pflegekräften waschen lassen oder bestehen auf rituelle Waschungen. Andere empfinden Körperkontakt mit Fremden als unangenehm.
- Tagesstruktur: Integriere religiöse Rituale (z. B. Gebetszeiten) oder gewohnte Abläufe, wenn möglich. Das schafft Sicherheit.
Nicht alles lässt sich immer umsetzen, aber wenn du fragst, erklärst und ehrlich kommunizierst, entsteht Vertrauen.
Integration kultureller Feste und Bedürfnisse
Kultursensible Pflege im Pflegealltag bedeutet auch: Du siehst den Menschen nicht nur in seiner Erkrankung, sondern in seiner ganzen Lebenswelt. Kulturelle oder religiöse Feiertage wie Ramadan, Weihnachten, Nowruz oder das chinesische Neujahr haben eine große Bedeutung – auch im Pflegeheim.
Wenn du solche Feste zumindest wahrnimmst, erwähnst oder kleine Zeichen der Anerkennung setzt, fühlen sich Menschen gesehen. Das kann ein festlicher Essensplan sein, passende Deko, ein kleines Gespräch oder Raum fürs Gebet.
Praxisbeispiel: In einigen Pflegeeinrichtungen wurden Gebetsräume eingerichtet oder interkulturelle Kalender genutzt, um Feiertage aller Bewohner:innen im Blick zu behalten.
.webp?width=825&height=550&name=moslemischer-gebetsraum%20(1).webp)
Rolle der Familie
In vielen Kulturen ist die Familie das Herzstück der Pflege. Angehörige übernehmen nicht nur Betreuung, sondern treffen oft auch Entscheidungen, manchmal sogar über die Köpfe der Pflegebedürftigen hinweg. In Ländern wie der Türkei, China oder Indien ist es üblich, dass Kinder oder der Familienrat bei medizinischen Fragen mitentscheiden.
Für Pflegekräfte bedeutet das: Angehörige einbeziehen, ohne die Autonomie der Pflegebedürftigen zu übergehen. Ein offenes Gespräch hilft, Rollen zu klären und gemeinsam Lösungen zu finden.
Umgang mit Schmerzen und Sterben
Schmerz wird nicht überall gleich gezeigt. Während einige Kulturen Schmerz offen äußern, gilt in anderen Zurückhaltung als Zeichen von Stärke.
Auch der Umgang mit dem Sterben variiert: Manche wünschen intensive spirituelle Begleitung, andere bevorzugen Stille und Rückzug. Pflegekräfte sollten daher aufmerksam beobachten, nachfragen und individuelle Wünsche respektieren. Ein sensibler Umgang mit diesen Themen fördert Vertrauen und ermöglicht eine würdevolle Begleitung.
Externe Ressourcen einbeziehen
Scheue dich nicht, Hilfe von außen zu nutzen. In vielen Städten findest du Migrantinnen-Organisationen, Kulturvereine oder Religionsgemeinschaften, die dich beraten können – zum Beispiel, welche Speisen für ein bestimmtes Fest wichtig sind oder wer beim Dolmetschen unterstützen kann.
Manche Einrichtungen arbeiten erfolgreich mit Moscheen, Kirchen oder interkulturellen Beratungsstellen zusammen, um ihr Angebot anzupassen. Auch Angehörige sind oft Expertinnen für die Kultur ihrer Familienmitglieder. Kurz gesagt: Vernetze dich und öffne den Blick nach außen. So passt du die Pflege wirklich an die Menschen an, die du betreust.
Modelle kultursensibler Pflege: Leininger & mehr
Wenn du kultursensibel pflegen willst, hilft dir ein klares Modell. Es zeigt dir, worauf du achten solltest und wie du kulturelle Unterschiede systematisch in deine Pflege integrierst.
Leininger: Pionierin der transkulturellen Pflege
Madeleine Leininger entwickelte in den 1970er-Jahren das bekannteste Modell: die transkulturelle Pflege nach Leininger. Ihr Ansatz basiert auf der Überzeugung, dass Kultur einen entscheidenden Einfluss auf Gesundheit, Krankheit und Pflegeverhalten hat. Sie forderte: Pflegekräfte müssen die Kultur ihrer Patient:innen kennen und respektieren, um gute Pflege leisten zu können.
Im Zentrum steht das Sunrise-Modell. Es hilft dir, folgende Aspekte zu beachten:
- kulturelle Werte, Rituale, Glaubenssysteme
- Sprache, soziale Rolle, Religion
- wirtschaftliche, rechtliche und politische Einflüsse
- Umwelt, Erziehung und Technologie
Das Ziel: Pflege planen, die kulturell sinnvoll und fachlich vertretbar ist – entweder durch Erhaltung (z. B. Gewohnheiten beibehalten), Anpassung (z. B. Alternativen anbieten) oder Neugestaltung (z. B. Gesundheitsverhalten fördern).
Eine kurze, praxisnahe Erklärung findest du in diesem Video:
Weitere Modelle der kultursensiblen Pflege
Neben Leininger gibt es weitere Modelle der transkulturellen und kultursensiblen Pflege, die du kennen solltest:
- Papadopoulos, Tilki & Taylor-Modell: Fokus auf kulturspezifisches Wissen, Selbstreflexion, Empathie und Kommunikation. Es betont die Entwicklung kultureller Kompetenz als Prozess.
- Giger & Davidhizar Modell: Hebt sechs Kulturdimensionen hervor – z. B. Kommunikationsstil, Zeitverständnis oder soziale Organisation – um Unterschiede gezielt zu erfassen.
- Campinha-Bacote Modell: Sieht kultursensible Pflege als dynamischen Lernprozess mit fünf Schritten: Bewusstsein, Wissen, Fähigkeiten, Begegnung, Verlangen).
Du musst kein Modell auswendig lernen. Aber du solltest wissen, dass es systematische Ansätze gibt, die dir helfen, kultursensible Pflege bewusst und professionell umzusetzen. Sie geben dir Orientierung – besonders, wenn du mit unbekannten kulturellen Situationen konfrontiert wirst.
Kultursensible Pflege in verschiedenen Settings
Kultursensible Pflege ist überall wichtig, aber je nach Setting sieht sie anders aus. Denn im Krankenhaus, im Pflegedienst oder im Heim gelten andere Abläufe, Zeitfenster und Rahmenbedingungen.
Kultursensible Krankenpflege (Krankenhaus)
Im Krankenhaus zählt oft jede Minute. Trotzdem kannst du auch hier kultursensibel handeln, zum Beispiel, indem du kurz nach Sprache, Religion oder Pflegewünschen fragst. Besonders wichtig:
- Dolmetscher frühzeitig einbinden, v. a. bei Aufklärung oder Entlassung
- Religiöse Bedürfnisse (z. B. Gebet, Ernährung) beachten; gerade vor OPs der in Notaufnahmen
- Körperpflege respektvoll planen, z. B. bei Wunsch nach gleichgeschlechtlicher Pflege
- Angehörige einbeziehen, wenn sie eine wichtige Rolle in Entscheidungen spielen
Kultursensibler Pflegedienst (ambulant)
In der häuslichen Umgebung hast du mehr Spielraum, aber auch mehr Verantwortung. Hier geht es darum, Pflege mit dem Alltag der Menschen zu verbinden:
- Frage aktiv nach Essgewohnheiten, Gebeten, Ritualen oder Schamgrenzen.
- Plane so, dass der Tagesablauf nicht gestört wird, z. B. bei Fastenzeiten oder Feiertagen.
- Achte auf deine Kommunikation mit Angehörigen. Sie sind oft zentrale Bezugspersonen.
- Respektiere, wenn Räume, Kleidung oder religiöse Symbole eine besondere Bedeutung haben.
Kultursensible Altenpflege
In der stationären Altenpflege ist Zeit für Biografiearbeit, und die solltest du nutzen. Viele Bewohner:innen leben seit Jahrzehnten mit bestimmten Routinen. Kultursensibilität bedeutet hier:
- Pflegeplanung auf kulturelle Werte abstimmen.
- Speisepläne anpassen (halal, koscher, vegetarisch, laktosefrei etc.).
- Feiertage und Feste aller Religionen berücksichtigen, auch dekorativ oder kulinarisch.
- Offenheit im Team fördern: Was du nicht kennst, kannst du erfragen.
Fazit: In jedem Setting sieht kultursensible Pflege anders aus, aber der Kern bleibt gleich: Du schaust genau hin, fragst nach und respektierst, was deinem Gegenüber wichtig ist.
Wer trägt Verantwortung für kultursensible Pflege?
Kultursensible Pflege ist Teamarbeit. Damit sie im Alltag funktioniert, müssen alle Ebenen mitziehen.
Leitung
Die Einrichtungsleitung schafft die Rahmenbedingungen: Sie sorgt für Schulungen, stellt mehrsprachige Materialien bereit und lebt Vielfalt vor. Ohne Rückendeckung von oben bleibt Kultursensibilität Theorie.
Pflegedienstleitung
Die PDL organisiert den Alltag. Sie achtet darauf, dass Wünsche nach gleichgeschlechtlicher Pflege, Dolmetschern oder kulturspezifischen Mahlzeiten ernst genommen und umgesetzt werden. Sie entscheidet, ob kultursensibel wirklich „mitgeplant“ wird oder nur als Zusatz läuft.
Pflege- und Betreuungsteam
Du als Pflegekraft bist das Gesicht der Pflege. Du begegnest Menschen mit Respekt, fragst nach ihren Wünschen und reagierst sensibel. Im Team sprecht ihr über Erfahrungen, Unsicherheiten und Lösungen. Kultursensible Pflege gelingt nur, wenn ihr euch austauscht.
Träger & Organisation
Träger und Verbände geben Strukturen vor: Leitlinien, Fortbildungen, Qualitätssicherung. Sie entscheiden, ob Vielfalt Teil der Unternehmenskultur ist oder ein Randthema bleibt.
Weiterbildung & Materialien für kultursensible Pflege
Hier findest du eine Auswahl an hochwertigen Materialien und Weiterbildungen für kultursensible Pflege.
- Online-Fortbildung “Vielfalt Pflegen”: Eine vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte eLearning-Plattform speziell für die transkulturelle Pflege. Pflegeeinrichtungen können ihre Mitarbeitenden hier kostenlos schulen lassen. Die interaktiven Module vermitteln Grundlagen zu Kultur, Kommunikation, Religion und geben praxisnahe Tipps. Nach erfolgreichem Abschluss erhält man sogar ein Zertifikat mit Fortbildungspunkten. Die Plattform ist orts- und zeitunabhängig nutzbar (www.vielfalt-pflegen.info).
- Weiterbildung zur Fachkraft für kultursensible Pflege: Verschiedene Bildungsträger und (Fach-)Hochschulen bieten Zertifikatskurse an, in denen vertiefte Kenntnisse vermittelt werden. Inhalte sind oft interkulturelle Kommunikation, migrationsspezifische Gesundheitsaspekte, rechtliche Rahmenbedingungen und praktische Übungen. Infos findest du hier: pflegestudium.de
- Leitfäden und Handreichungen: Nutzen Sie vorhandenes Wissen aus der Praxis! Es gibt erprobte Ratgeber, etwa das Handbuch „Für eine kultursensible Altenpflege“oder Broschüren von Wohlfahrtsverbänden (z. B. Caritas, Diakonie) mit Tipps zum Umgang mit verschiedenen Kulturen.
Fazit: Kultursensible Pflege als Schlüssel zu besserer Versorgung
Kultursensible Pflege ist kein Extra, sondern Teil deines beruflichen Anspruchs. Sie hilft dir, Missverständnisse zu vermeiden, Vertrauen aufzubauen und Menschen wirklich zu erreichen – egal, woher sie kommen oder wie sie leben. Du musst nicht alles wissen, aber offen sein, zuhören und nachfragen. Kleine Gesten machen oft den größten Unterschied.
Ob im Krankenhaus, in der ambulanten Pflege oder im Heim: Du kannst kultursensible Pflege im Alltag umsetzen – Schritt für Schritt. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Haltung. Und die beginnt bei dir.
Du möchtest dich mit anderen Pflegekräften austauschen oder suchst einen neuen Job, wo Vielfalt geschätzt wird? Dann melde dich jetzt kostenlos an.
.webp)



%20aktuell.png?width=300&height=300&name=Podcast%20Cover%20(Close%20Up)%20aktuell.png)