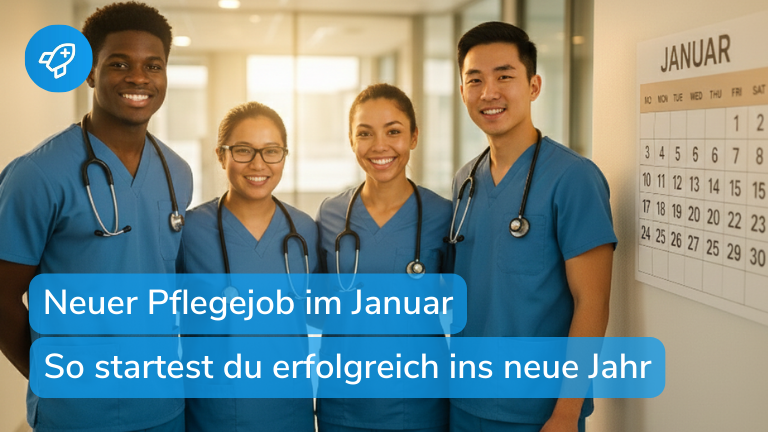Zusammenfassung: Das Wichtigste zur Krankenhausreform in Kürze
- Krankenhäuser sollen künftig nicht mehr ausschließlich eine Fallpauschale, d. h. eine Vergütung pro Fall, sondern eine Vorhaltevergütung für das Bereitstellen von Kapazitäten erhalten.
- Einführung von Leistungsgruppen und Qualitätskriterien zur Sicherung und Steigerung der Behandlungsqualität.
- Zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung sind Ausnahmeregelungen für den ländlichen Raum vorgesehen.
- Förderung sektorenübergreifender und integrierter Gesundheitsversorgung, besonders in strukturschwachen Regionen.
- Ein Transformationsfonds soll die finanziellen Ressourcen für notwendige strukturelle Veränderungen bereitstellen.
- Der Verwaltungsaufwand in Krankenhaus soll deutlich verringert werden.
Warum ist eine Krankenhausreform notwendig?
In Deutschland gibt es etwa 1800 Krankenhäuser mit rund 480.000 Betten (Statistisches Bundesamt). Die durchschnittliche Bettenauslastung liegt bei 69 %. Das Problem: zu viele ungenutzte Betten. Bezogen auf die Einwohnerzahl hat Deutschland die meisten Betten in Europa. Karl Lauterbach zufolge sind es zu viele Krankenhäuser, für die es weder Bedarf noch Geld und Personal gibt.
Laut Ärzteblatt sind 11 % der Häuser in einem „roten Bereich“, was eine erhöhte Insolvenzgefahr bedeutet. 2024 solle, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zufolge, aufgrund erheblicher Kostensteigerungen ein finanziell schwieriges Jahr werden.
Um ihre finanzielle Situation zu verbessern, neigen die Kliniken dazu, eine möglichst hohe Anzahl an Eingriffen durchzuführen – auch wenn diese nicht unbedingt vonnöten sind. Schließlich werden Sie pro Fall bezahlt. Ebenso werden aus Kostengründen Therapien vorenthalten (Ärztezeitung). Dies hatte in der Vergangenheit zur Folge, dass Deutschland im internationalen Vergleich, insbesondere was künstliche Hüft- und Kniegelenke angeht, auf den vorderen Plätzen steht (statista).
Das aktuelle Modell gefährdet vornehmlich kleine Kliniken auf dem Land, die nicht genug Fälle haben. Zudem seien ganze Fachbereiche in diesem System schwer finanzierbar, etwa die Kinderstation und die Pflege. Erschwerend hinzu kommt der immer gravierender werdende Fachkräftemangel (→ Pflegenotstand).
.png?width=825&height=550&name=krankenhaus-auf-dem-land%20(1).png)
Was sind die Ziele der Krankenhausreform?
Das Eckpunktepapier zur Krankenhausreform, auf das sich Bund und Länder nach zähem Ringen geeinigt haben, nennt drei zentrale Ziele:
Versorgungssicherheit in Krankenhäusern
Die Reform zielt darauf ab, eine flächendeckende und qualitativ hochwertige Versorgung in allen Regionen Deutschlands sicherzustellen. Insbesondere in strukturschwachen und ländlichen Gebieten soll sie eine bedarfsgerechte medizinische Versorgung fördern.
Behandlungsqualität sichern
Ein weiteres Ziel ist es, die medizinische Behandlungsqualität zu verbessern. Durch spezifische Leistungsgruppen, die an klar definierte Qualitätskriterien geknüpft sind, werden Krankenhäuser dazu angehalten, hohe medizinische Standards zu erfüllen.
Bürokratie abbauen und Kosten senken
Einer Studie des Marburger Bundes zufolge verbringen Ärzt:innen mindestens drei Stunden pro Tag mit administrativen Aufgaben. Auch ein Großteil der Pflegekräfte verbringt teils über die Hälfte ihrer Arbeitszeit für Bürokratisches (Asklepios). Die Krankenhausreform sieht unter anderem eine vereinfachte Vergütung und das Vermeiden von Doppelprüfungen vor.
Um diese Ziele zu erreichen, bekommen die Krankenhäuser künftig eine Vorhaltevergütung für Leistungsgruppen. Diese bemisst sich an Qualitätskriterien und wird ihnen von den jeweiligen Bundesländern zugewiesen.
.png?width=825&height=550&name=buerokratie-krankenhaus%20(1).png)
Eckpfeiler der Krankenhausreform: Was soll sich ändern?
Vorhaltepauschalen: Finanzierung der Verfügbarkeit
Die geplante Reform sieht vor, dass Krankenhäuser künftig 60 % ihrer Vergütung dafür bekommen, bestimmte wichtige medizinische Dienste ständig bereitzustellen, unabhängig davon, wie viele Patienten diese Dienste tatsächlich in Anspruch nehmen. Statt also pro Knie-Operation bezahlt zu werden, erhalten Krankenhäuser eine Vergütung dafür, dass sie diesen Eingriff anbieten.
Hiermit möchte Lauterbach, dass Krankenhäuser nicht nur die Behandlungen anbieten, mit denen sie viel Geld verdienen können, sondern auch die, die zwar teuer, aber notwendig sind. Ebenso soll verhindert werden, dass Krankenhäuser unnötiger, aber lukrative Eingriffe durchführen. Besonders kleinere Krankenhäuser auf dem Land, die nur wenige Eingriffe durchführen, sollen durch diese Maßnahmen besser unterstützt werden, damit sie weiter existieren können.
Zusätzliche Gelder gibt es allerdings nicht. Stattdessen wird umgeschichtet. Das Geld für die Vorhaltepauschalen kommt aus dem Topf der Fallpauschalen.
DRG-Systems: Abrechnung neu gestalten
Das DRG-System (Diagnosis Related Groups) ist eine Methode zur Abrechnung von Krankenhausleistungen mittels Fallpauschalen. Das bedeutet: Für eine Blinddarmoperation bekommt ein Krankenhaus einen festen Betrag, der das gesamte Spektrum der notwendigen Behandlungen abdeckt.
Die Vorhaltevergütungen sollen künftig in das DRG-System integriert werden. Hierzu werden die Fallpauschalen reduziert und das frei gewordene Geld wird für die Vorhaltevergütungen verwendet. Das neue System sieht vor, dass 60 % der Fallpauschalen durch den Vorhalteanteil ersetzt werden. 40 % müssen von den Krankenhäusern über Fälle erwirtschaftet werden.
Um das System einfacher und transparenter zu machen, werden auch einige zusätzliche Gebühren und Zuschläge überarbeitet oder ganz abgeschafft. Das soll den bürokratischen Aufwand verringern und die Finanzierungsstruktur klarer machen.
In der Anfangsphase der Reform wird die Höhe der Vorhaltevergütungen zunächst pauschal festgelegt, basierend auf Durchschnittswerten. Später wird die Berechnung dieser Vergütungen genauer angepasst, um sie den tatsächlichen Kosten und Bedürfnissen der Krankenhäuser besser anzupassen. Ziel ist es, eine faire und angemessene Bezahlung zu gewährleisten, die den realen Gegebenheiten in den Krankenhäusern entspricht.
Bürokratieabbau im Klinikalltag
Um die Bürokratie in Krankenhäusern zu reduzieren, unternimmt die Krankenhausreform verschiedene Schritte wie das Zusammenfassen von ähnlichen Verwaltungsvorgängen oder das Vermeiden von Doppelprüfungen.
Zusätzlich sollen verschiedene finanzielle Zuschläge in die Vorhaltevergütung integriert werden. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass sich das Krankenhauspersonal mehr auf die Patientenversorgung konzentrieren kann und weniger Zeit mit Papierarbeit verbringt.
Einteilung in Leistungsgruppen
Bei der geplanten Krankenhausreform in Deutschland spielen Leistungsgruppen eine zentrale Rolle. Es gibt insgesamt 65 verschiedene Leistungsgruppen, die festlegen, welche Art von medizinischen Leistungen ein Krankenhaus anbieten darf. Innerhalb dieser Gruppen wird jede medizinische Leistung kategorisiert, und die Krankenhäuser werden diesen Gruppen zugeordnet.
Die Zuweisung basiert auf spezifischen Qualitätskriterien, die von den Landesbehörden festgelegt werden. Damit ein Krankenhaus diese Leistungen anbieten kann, muss es bestimmte Anforderungen erfüllen, wie die nötige technische Ausstattung und genügend Fachärzt:innen und Pflegekräfte. Ein Medizinischer Dienst soll regelmäßig überprüfen, ob die Krankenhäuser die Qualitätsanforderungen einhalten.
Diese Anforderungen können auch durch Kooperationen mit anderen Einrichtungen erfüllt werden. Das ermöglicht es den Krankenhäusern, Netzwerkstrukturen aufzubauen und qualitativ hochwertige medizinische Leistungen über verschiedene Einrichtungen hinweg anzubieten.
Solche Verbünde können die Versorgung in spezialisierten Bereichen wie Infektiologie, Notfallmedizin, spezieller Traumatologie und spezialisierter Kinder- und Jugendmedizin verstärken, die zu den fünf neuen ergänzenden Gruppen zählen.
Sektorenübergreifende Versorgung
Ein wichtiger Teil des neuen Gesetzes ist die sektorenübergreifende Versorgung. Das bedeutet, dass Krankenhäuser nicht nur stationäre, sondern auch ambulante Leistungen anbieten können, die sonst in Arztpraxen stattfinden. Besonders in Regionen mit wenigen Ärzten sichert das eine umfassendere Versorgung.
Durch das Konzept der sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen, auch 'Level 1i-Krankenhäuser' genannt, wird die wohnortnahe medizinische Grundversorgung verbessert. Diese Einrichtungen bieten eine Kombination aus stationären, ambulanten und pflegerischen Leistungen an einem Ort. Damit werden sie zu einer wichtigen Brücke zwischen ambulanter und stationärer Versorgung.
Krankenhäuser in ländlichen Regionen, die andernfalls schließen müssten, können so weiterhin bestehen. Die Länder entscheiden, welche Krankenhäuser diese Rolle übernehmen. Die Vergütung erfolgt über spezifische Tagesentgelte für stationäre Leistungen und etablierte Entgelte für ambulante Leistungen.
Klinikatlas: Transparenz schaffen
„Patientinnen und Patienten haben ein Recht, zu erfahren, was Kliniken leisten.“, so Karl Lauterbach. Begleitend zur Krankenhausreform wurde daher im März 2024 das Krankenhaustransparenzgesetz verabschiedet.
Dieses Gesetz sorgt dafür, dass Patienten seit Mai 2024 online die Qualität und Leistungen von Kliniken vergleichen können. In einem bundesweiten Klinikatlas können Patient: innen Informationen über 1.700 Kliniken zugänglich sein, darunter angebotene Behandlungen, Personalschlüssel, Häufigkeit von Eingriffen und Komplikationsraten.
Die Daten für den Klinikatlas stammen von den Krankenhäusern selbst, Zertifizierungsstellen und Krankenkassen. Diese Informationen werden regelmäßig aktualisiert, können aber bis zu zwei Jahre alt sein.
Zeitlicher Fahrplan: Die wichtigsten Termine und Fristen
- 2003: Die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmid führt die Fallpauschalen ein. Das Modell löst die damalige Bezahlung nach der Liegezeit ab.
- 10. Juli 2023: Nach monatelangen, zähen Verhandlungsrunden einigt sich Lauterbach mit den Ländern auf ein gemeinsames Eckpunktepapier und dem festen Vorsatz, gemeinsam das Gesetz zur Krankenhausreform zu schreiben.
- Dann: Zerwürfnis mit den Ländern. Lauterbach hat das Gesetz im Alleingang zu Ende geschrieben – und anders als ursprünglich geplant hat er es so formuliert, dass der Bundesrat nicht zustimmen muss.
- 15.05.2024: Das Kabinett hat die Krankenhausreform gebilligt. Die Bundesregierung hat sich also am Mittwoch hinter das wichtigste Vorhaben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gestellt.
- 17.10.2024: Der Bundestag hat nach hitziger Debatte die Krankenhausreform beschlossen. Kritik gibt es von der Opposition und vonseiten der Länder.
- 21.03.2025: Der Bundesrat hat dem Transformationsfonds zur Krankenhausreform zugestimmt. Der Fonds umfasst bis zu 50 Milliarden Euro, finanziert je zur Hälfte aus Beitragsmitteln des Bundes und aus Landesmitteln (Pressemitteilung Bundesgesundheitsministerium).
- ab 2026: Der Transformationsfond steht für eine Dauer von 10 Jahren zur Verfügung.
- 2027: „Zusätzliche Leistungen soll es laut Entwurf ab 2027 etwa für die Bereitstellung von Kindermedizinstationen (288 Millionen Euro), Geburtshilfestationen (120 Millionen Euro), Schlaganfallstationen (35 Millionen Euro) und Intensivstationen (30 Millionen Euro) geben.“
- 2029: ist eine Evaluation vorgesehen
Kritik an der Krankenhausreform
Die geplante Krankenhausreform hat bereits im Vorfeld zahlreiche Diskussionen und Kontroversen ausgelöst. Befürworter sehen in der Reform eine notwendige Maßnahme, um die Effizienz und Qualität der Gesundheitsversorgung zu steigern.
Kritiker hingegen warnen vor den möglichen negativen Auswirkungen, insbesondere für ländliche Gebiete und finanziell angeschlagene Kliniken. Die Reformpläne sind ambitioniert und werfen viele Fragen auf, die noch einer Klärung bedürfen.
Umstrukturierung: Wer trägt die Kosten?
Mit der Krankenhausreform wird es grundsätzlich nicht mehr Geld im System geben. Erst wenn sich die Gesamtzahl der Krankenhäuser verringert hat, wird es mehr zu verteilen geben.
Damit die Reform erfolgreich ist, müssen einige Krankenhäuser umstrukturiert, zusammengelegt oder geschlossen werden. Diese Maßnahmen erfordern erhebliche finanzielle Mittel. Deshalb sollen die Krankenkassen und die Länder ab 2026 jeweils 25 Milliarden Euro bereitstellen.
Es stellt sich die Frage, wie viel uns unsere Gesundheit wert ist. In der Vergangenheit sind die Länder ihren Verpflichtungen nicht immer nachgekommen. Es ist daher positiv, dass sie nun stärker in die Pflicht genommen werden. Diese Maßnahmen werden zweifellos teuer sein, aber sie sind notwendig, um eine nachhaltige und effiziente Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.
Kurzfristige Gefahren von Kliniksterben
Lauterbach zufolge sind es zu viele Krankenhäuser, für die es weder Bedarf noch Geld und Personal gibt. Mit der Reform einhergehen, soll daher eine Reduktion der Krankenhäuser. Dies soll allerdings kontrolliert geschehen. Es dürfen keine Kliniken schließen, die essenziell für die Versorgung sind.
Die Gefahr, dass aber genau dies geschieht groß ist. Denn viele Kliniken schreiben rote Zahlen und halten nicht mehr lange durch. Erste positive Effekte der Krankenhausreform werden erst 2027/2028 erwartet. In vielen Kliniken herrscht die Sorge, dass sie bis dahin nicht mehr existieren oder Fachbereiche schließen müssen.
Bund‑Länder‑Streit um Zuständigkeiten
Die Länder werfen dem Bundesgesundheitsminister vor, durch seine Qualitätsvorgaben indirekt die Krankenhausplanung zentralisieren zu wollen. Dies ist traditionell jedoch die Aufgabe der Bundesländer. Sie kritisieren, dass Lauterbach ihnen zu sehr reinredet und befürchten, am Ende verantwortlich gemacht zu werden, wenn Krankenhäuser schließen. Daher fordern sie mehr Flexibilität und Ausnahmen von den Qualitätsvorgaben des Bundes.
Karl-Josef Laumann, Gesundheitsminister von NRW, betont, man könne nicht über jedes Krankenhaus eine Bundesschablone legen. Hierfür seien die Strukturen in den Bundesländern zu unterschiedlich (Ärzteblatt). Auch Bayern drohte bereits mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht (bayern.de).
Ein zentraler Streitpunkt bleibt das Geld. Die Länder fordern vom Bund finanzielle Unterstützung für den Umbau der Kliniklandschaft und zusätzliche Soforthilfen, um angeschlagene Krankenhäuser kurzfristig vor der Pleite zu retten.
Auch die Krankenkassen befürchten massive Mehrausgaben und Beitragssteigerungen. Der Bund will seinen Anteil aus dem Gesundheitsfonds der Krankenkassen finanzieren, was zu weiteren Klagen führen könnte.
Gesundheitskioske sind nicht mehr Teil der Reform
Um die Gesundheitsversorgung insbesondere in ländlichen Regionen zu sichern, wollte Lauterbach Gesundheitskioske einführen. Die Kioske sollten eine niedrigschwellige Anlaufstelle für medizinische Versorgung und Beratung sein. Geplant war, dass hier multiprofessionelle Teams präventiv beraten und im Idealfall auch Verordnungen ausstellen können.
Ziel war es auch, durch frühzeitige Beratung und Behandlung den Ansturm auf Krankenhäuser und Notfallambulanzen zu verringern. Außerdem sollte die Kioske dazu beitragen, die soziale Ungerechtigkeit im Gesundheitssystem zu verringern. Die Gesundheitskioske sollten zu 20 % von den Kommunen und zu 80 % von den Krankenkassen finanziert werden.
Das Projekt scheint nun allerdings gescheitert. Die Gesundheitskioske wurden im April 2024 aus dem Referentenentwurf zum Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) gestrichen. Widerstand kam unter anderem von der FDP, die Zweifel an der Notwendigkeit und Effektivität der Kioske äußerte. Kritiker bemängelten auch, dass mit den Kiosken Doppelstrukturen geschaffen würden und qualifizierte Fachkräfte für den Betrieb fehlen.
Video: Krankenhausreform einfach erklärt
In dieser Podcast-Folge spricht Denise Ni mit unserem Experten Silvan Schroeren, Geschäftsführer und Mitgründer von Care Rockets, über die Chancen, die die Reform mit sich bringt, was noch besser hätte sein können und was das für die Menschen in der Pflege und den Pflegenotstand bedeutet.
.png)


%20aktuell.png?width=300&height=300&name=Podcast%20Cover%20(Close%20Up)%20aktuell.png)