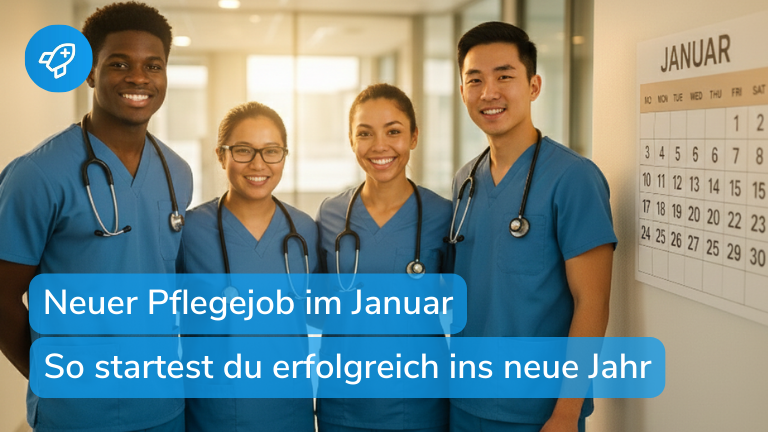Was ist das 7/7-Modell in der Pflege? – Definition, Ablauf und Ziele
Das 7/7-Arbeitszeitmodell ist ein alternatives Arbeitszeitmodell in der Pflege, das auf feste Blockdienste setzt: 7 Tage Dienst – 7 Tage frei. Anstatt sich täglich durch Früh-, Spät- oder Nachtdienste zu rotieren, arbeiten Pflegekräfte eine Woche am Stück im festen Schichtturnus – meist im Tag- oder Nachtdienst – und haben anschließend eine komplette Woche frei.
Ziel des Modells:
- Bessere Planbarkeit für Pflegekräfte
- Mehr Erholung durch blockfreie Zeit
- Weniger Stress durch Dienstplanwechsel
- Stärkere Personalbindung für Pflegeeinrichtungen
Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit liegt bei ca. 35 Stunden – verteilt auf sieben Diensttage à rund 10 Stunden netto. Das Modell kommt der steigenden Nachfrage nach planbarer Freizeit und geregeltem Arbeitsalltag in der Pflege entgegen.
Arbeitszeitmodell erklärt: 7 Tage Dienst – 7 Tage frei
Im 7/7-Modell übernehmen Pflegekräfte eine Woche lang durchgängig Früh- oder Nachtdienste – typischerweise im 12-Stunden-Rhythmus mit zwei Stunden Pause. Nach sieben aufeinanderfolgenden Arbeitstagen folgt eine volle Woche Freizeit. Damit entsteht ein klarer Zwei-Wochen-Rhythmus, in dem sich zwei feste Teams regelmäßig abwechseln.
Für Pflegekräfte bedeutet das:
- Weniger Schichtwechsel, keine spontane Diensttausche
- Mehr Struktur im Alltag und verlässliche Wochenendplanung
- Bessere Work-Life-Balance, z. B. durch Urlaube mit nur wenigen Urlaubstagen
Beispiel: Mit nur 7 Urlaubstagen kann man durch Vor- und Nachblock bis zu 21 Tage am Stück frei haben.
Die folgende Übersicht stellt die wichtigsten Unterschiede zum klassischen 3-Schicht-System gegenüber.
| Kriterium | 7/7-Modell | 3-Schicht-System |
|---|---|---|
| Rhythmus | 7 Tage Arbeit, 7 Tage frei | Früh-, Spät-, Nachtdienst im Wechsel |
| Stunden/Tag | ca. 10 h | 7–8 h |
| Vorteile | Lange Erholungsphasen, weniger Übergaben, planbar | Kürzere Schichten, gleichmäßige Verteilung |
| Nachteile | Lange Schichten, hohe Belastung in Arbeitswoche | Häufige Übergaben, wechselnde Schlafrhythmen |
Für welche Pflegeeinrichtungen eignet sich das 7/7-Modell?
Das 7/7-Arbeitszeitmodell passt besonders gut in stationäre Pflegeeinrichtungen mit dauerhaftem 24/7-Betrieb, zum Beispiel in der Altenpflege, in Pflegeheimen oder Wohnbereichen mit demenziell erkrankten Menschen.
Einrichtungen mit konstantem Personalbedarf und kontinuierlicher Betreuung profitieren von der festen Wochenstruktur: Pflegekräfte begleiten Bewohner sieben Tage am Stück und bauen in dieser Zeit stabile Beziehungen auf.
Für Kliniken oder ambulante Pflegedienste mit sehr wechselndem Pflegebedarf kann die Umsetzung dagegen herausfordernder sein. Dort sind oft mehr Schnittstellen nötig, was die Vorteile des festen 7/7-Rhythmus abschwächen kann.
Praxisbeispiel:
Das Pflegewohnstift Hönow (DSG) in Brandenburg arbeitet seit 2010 mit dem 7/7-Modell. Die Rückmeldungen von Pflegekräften sind überwiegend positiv – besonders wegen der festen Dienststruktur, mehr Freizeit und des reduzierten Stresses.
Warum das 7/7-Modell in der Pflegebranche immer beliebter wird?
Immer mehr Pflegeeinrichtungen setzen auf neue Wege, um Pflegepersonal zu gewinnen und zu halten. Das 7/7-Modell bietet gleich mehrere Vorteile, die zur steigenden Beliebtheit beitragen:
Pflegekräfte schätzen:
- Klare Dienststruktur ohne spontane Schichtwechsel
- Verlässliche Freiwochen für Familie, Erholung oder Nebenaktivitäten
- Weniger mentale Belastung durch kontinuierliches Arbeiten im festen Turnus
- Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
Arbeitgeber profitieren von:
- Weniger Krankmeldungen und geringerer Fluktuation
- Effizienterer Dienstplanung mit festen Zweier-Teams
- Stärkerer Personalbindung durch zufriedenere Mitarbeitende
Besonders in Zeiten von Fachkräftemangel und wachsendem Wettbewerbsdruck ist das Modell ein wertvoller Baustein für das Employer Branding.
Vorteile des 7/7-Arbeitszeitmodells für Pflegekräfte
Das klassische Schichtsystem bringt viele Pflegekräfte an ihre Belastungsgrenze: unregelmäßige Dienstzeiten, spontane Einsätze und fehlende Erholung gehören zum Alltag.
Das 7/7-Arbeitszeitmodell setzt hier einen Kontrast. Es bündelt die Arbeitszeit in klar definierte Phasen und schafft regelmäßige Freiräume – ohne ständiges Hin und Her im Dienstplan.
Blockfreier Rhythmus: Wie Pflegekräfte von mehr Freizeit profitieren
Pflegekräfte im 7/7-Modell haben nach sieben aufeinanderfolgenden Diensten eine volle Woche frei – ohne Rufbereitschaft oder Einspringen. Diese blockfreie Zeit sorgt für spürbar mehr Erholung und eine bessere Work-Life-Balance.
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
- Mehr Regeneration: Eine freie Woche ermöglicht tieferes Abschalten als vereinzelte freie Tage.
- Planbare Freizeit: Arzttermine, Kurztrips oder private Projekte lassen sich langfristig organisieren.
- Urlaubstage effektiv nutzen: Mit geschicktem Einsatz von Urlaub entstehen bis zu drei Wochen am Stück frei.
- Privates und Berufliches trennen: Während der Dienstwoche Fokus auf den Job, danach komplette Erholung.
Viele Pflegekräfte empfinden das Modell nicht als Entlastung im Sinne von „weniger Arbeit“, sondern als Gewinn an Lebensqualität und Klarheit.
| Tipp für Pflegekräfte: Du möchtest dich mit anderen Pflegekräften zum 7/7-Modell austauschen? Dann werde Teil unseres Netzwerks auf Care Rockets – kostenlos und deutschlandweit. |
Weniger Schichtwechsel – mehr Struktur und Ruhe
Im Gegensatz zum Drei-Schicht-System bringt das 7/7-Modell Ruhe in den Arbeitsalltag. Es gibt keine Spät-zu-Früh-Rotationen, keine Wechseldienste, keine ständigen Änderungen.
Was Pflegekräfte besonders schätzen:
- Konstante Schichtart: Eine Woche Tagdienst oder Nachtdienst – kein täglicher Wechsel
- Feste Dienstpläne für das ganze Jahr: Frühzeitige Planbarkeit für Beruf und Privatleben
- Mehr Fokus und weniger mentale Belastung: Der Kopf bleibt im Modus – keine Umstellungen alle zwei Tage
- Gleichbleibende Teams: Pflegekräfte arbeiten eine Woche im eingespielten Duo oder Trio – das stärkt Vertrauen und Zusammenarbeit
Auch Bewohner:innen profitieren von der Kontinuität: dieselben Ansprechpartner:innen über eine Woche hinweg sorgen für mehr Beziehungspflege und Verlässlichkeit.
Vorteile für Arbeitgeber: Weniger Ausfälle, bessere Planung & Mitarbeiterbindung
Das 7/7-Modell ist nicht nur für Pflegekräfte attraktiv: Auch Arbeitgeber in der Pflege profitieren. Neben besserer Planbarkeit stärkt das Modell das Employer Branding, reduziert krankheitsbedingte Ausfälle und schafft eine stabilere Personalsituation im Team.
Employer Branding: Pflegekräfte durch attraktive Arbeitszeitmodelle gewinnen
Employer Branding bedeutet: Eine Pflegeeinrichtung positioniert sich gezielt als attraktiver Arbeitgeber, um qualifizierte Pflegekräfte zu gewinnen und langfristig zu binden. Gerade im Pflegesektor, wo der Wettbewerb um Personal besonders hoch ist, wird das zur strategischen Notwendigkeit.
Employer Branding umfasst alle Maßnahmen, mit denen Pflegeeinrichtungen ihr Image als Arbeitgeber aufbauen und stärken – nach innen wie nach außen. Arbeitszeitmodelle spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie zeigen, ob eine Einrichtung die Bedürfnisse des Personals ernst nimmt.
Das 7/7-Modell unterstützt Employer Branding konkret durch:
- Modernes Arbeitgeberversprechen: Die Einrichtung zeigt, dass sie flexible, lebensphasenorientierte Arbeitsbedingungen bietet
- Positive Kommunikation: Pflegekräfte sprechen über das Modell – in Bewerbungsgesprächen, im Kollegenkreis oder auf Social Media
- Glaubwürdigkeit und Vertrauen: Mitarbeitende erleben echte Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben – kein leeres Versprechen
- Positionierung im Bewerbermarkt: Einrichtungen mit innovativen Modellen heben sich sichtbar von der Konkurrenz ab
Fazit: Wer das 7/7-Arbeitszeitmodell anbietet und transparent kommuniziert, wie es funktioniert, stärkt seine Arbeitgebermarke nachhaltig. So gelingt es nicht nur, neue Pflegekräfte zu gewinnen, sondern auch, bestehendes Personal langfristig zu halten.
| Tipp: Nutzen Sie das 7/7-Modell für Ihr Employer Branding: Möchten Sie Pflegekräfte mit modernen Arbeitszeitmodellen begeistern? Erstellen Sie jetzt kostenlos ein Unternehmensprofil auf Care Rockets – und sprechen Sie aktiv wechselwillige Pflegekräfte an. |
Dienstplanoptimierung mit dem 7/7-Modell
Das Modell bringt nicht nur Struktur für das Team, sondern auch spürbare Vereinfachung in der Dienstplanung:
Vorteile für die Einrichtungsleitunblockg & Dienstplangestaltung:
- Langfristige Planungssicherheit: Dienstpläne können für mehrere Monate oder das ganze Jahr festgelegt werden
- Feste Teams: Zwei feste Schichtgruppen wechseln sich ab – weniger Abstimmungen, weniger Chaos
- Weniger kurzfristige Diensttausche: Durch den Wochenrhythmus sinkt die Zahl spontaner Änderungen
- Bessere Abdeckung von Übergabezeiten: Überschneidungen am Schichtwechsel (z. B. 19:00 Uhr) ermöglichen saubere Übergaben
In der Praxis zeigt sich: Eine gut umgesetzte 7/7-Struktur reduziert Planungsaufwand und Personalengpässe, da verlässliche Routinen entstehen. Auch Schnittstellen zu anderen Abteilungen (Küche, Reinigung, Therapie) lassen sich besser koordinieren.
Wie das 7/7-Modell Krankheitsausfälle und Überlastung senkt
Ein zentrales Problem vieler Pflegeeinrichtungen: hohe Krankenstände durch Dauerbelastung. Genau hier setzt das 7/7-Modell an.
Ergebnisse aus der Praxis:
- Reduzierter Krankenstand: Pflegeeinrichtungen berichten von messbar weniger krankheitsbedingten Ausfällen
- Bessere Erholung = geringeres Burnout-Risiko
- Weniger Einspringen: Durch verlässliche Freiwoche wird das „ständige Abrufen“ vermieden
- Erhöhte Motivation: Mitarbeitende kehren erholter und strukturierter aus ihrer freien Woche zurück
In Häusern, die das Modell bereits umgesetzt haben (z. B. DSG Pflegewohnstift Hönow), zeigt sich: Die Belastung konzentriert sich auf eine Woche – doch die Erholungswoche gleicht sie aus. Das verbessert nicht nur die Gesundheit, sondern auch die langfristige Zufriedenheit und Bindung ans Unternehmen.

Nachteile & Grenzen des 7/7-Modells: Belastung, Eignung, rechtliche Aspekte
Trotz vieler Vorteile ist das 7/7-Arbeitszeitmodell kein Selbstläufer. Die intensive Dienstwoche, die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die individuellen Lebensumstände der Mitarbeitenden müssen beachtet werden. Wer das Modell einführt, sollte die möglichen Stolpersteine kennen und frühzeitig passende Lösungen entwickeln.
Längere Arbeitstage: Belastung oder effizientere Struktur?
In der Dienstwoche arbeiten Pflegekräfte im 7/7-Modell meist 12 Stunden brutto – effektiv etwa 10 Stunden Netto-Arbeitszeit pro Tag. Diese gebündelte Arbeitsbelastung wird von vielen als anstrengend empfunden, besonders gegen Ende der Woche.
Mögliche Belastungen:
- Konzentrationsabfall: Müdigkeit steigt an den letzten Tagen
- Weniger Privatleben während der Dienstwoche: Familie, Hobbys oder soziale Kontakte sind nur eingeschränkt möglich
- Erhöhtes Erholungsbedürfnis: Viele benötigen 1–2 Tage in der Freiwoche allein zur Regeneration
Jedoch berichten Pflegekräfte auch von mehr Ruhe im Arbeitsalltag:
- Keine Schichtwechsel innerhalb der Woche
- Feste Teams, feste Abläufe
- Besserer Tagesrhythmus durch Routine
Fazit: Die Dienstwoche ist fordernd – doch wer sie durchsteht, profitiert von einer vollen Woche echter Freizeit. Entscheidend ist, ob die Belastung durch ausreichende Pausen, gute Teamstruktur und eine gesunde Arbeitskultur abgefedert wird.
Eignung prüfen: Für wen ist das Modell (nicht) geeignet?
Das 7/7-Modell funktioniert nicht für jede Lebenssituation. Arbeitgeber sollten gemeinsam mit dem Team klären, wer realistisch daran teilnehmen kann – und wer nicht.
Besonders geeignet für:
- Pflegekräfte ohne Betreuungspflichten
- Berufseinsteiger oder Rückkehrer mit hoher Flexibilität
- Pendler:innen mit längerer Anfahrt (weniger Fahrten)
- Pflegekräfte, die feste Routinen schätzen
Weniger geeignet für:
- Alleinerziehende mit fehlender Kinderbetreuung in der Dienstwoche
- Mitarbeitende mit pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause
- Pflegekräfte mit gesundheitlichen Einschränkungen (z. B. Rücken, Kreislauf)
- Teammitglieder, die keine langen Schichten vertragen
Tipp für Arbeitgeber: Statt Zwang empfiehlt sich eine freiwillige Teilnahme. Viele Einrichtungen kombinieren 7/7 mit klassischen oder individuellen Arbeitszeitmodellen – so bleibt das System flexibel und gerecht.
Was sagt das Arbeitszeitgesetz? Rechtliche Stolpersteine vermeiden
Auch wenn das 7/7-Modell auf den ersten Blick ungewöhnlich wirkt: Es lässt sich mit dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) vereinbaren, wenn einige zentrale Punkte beachtet werden.
Wichtige Vorgaben im Überblick:
- Maximale Arbeitszeit pro Tag: 10 Stunden netto erlaubt (§ 3 ArbZG)
- Pause von mind. 30–45 Minuten bei > 6 Stunden Arbeitszeit (§ 4 ArbZG)
- Mindestruhezeit von 11 Stunden zwischen zwei Diensten (§ 5 ArbZG)
- Sonn- und Feiertagsruhe: muss innerhalb von 2 Wochen einmal gewährleistet werden (§ 11 ArbZG) – wird durch die Freiwoche erfüllt
- Durchschnittliche Wochenarbeitszeit: darf 48 Stunden im 6-Monats-Zeitraum nicht überschreiten – mit 35 Stunden im 7/7-Modell eingehalten
Wichtig für die Praxis:
- Dienstzeiten und Pausen müssen sauber dokumentiert werden
- Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen müssen ggf. angepasst oder ergänzt werden
- Die Umsetzung sollte mit dem Betriebsrat abgestimmt werden (§ 87 BetrVG)
Fazit: Rechtlich ist das 7/7-Arbeitszeitmodell machbar, aber nur mit einem sauberen Konzept. Arbeitgeber sollten frühzeitig juristische Beratung einholen und das Modell transparent mit dem Team abstimmen.
Welche Varianten des 7/7-Modells gibt es?
Nicht jede Pflegekraft kann oder möchte im klassischen 7/7-Rhythmus arbeiten. Umso wichtiger ist es, das Modell flexibel zu denken.
Viele Einrichtungen kombinieren das Prinzip „Blockdienst mit planbarer Freizeit“ mit individuellen Teilzeitlösungen oder kürzeren Wechselsystemen. So wird das Modell breiter einsetzbar ohne seinen Grundvorteil zu verlieren: Struktur und verlässliche Freizeit.
Teilzeit im 7/7-Modell: Flexibilität für unterschiedliche Lebenssituationen
Auch in Teilzeit lässt sich das 7/7-Modell umsetzen – mit angepasster Stundenzahl oder reduzierter Schichtanzahl pro Woche. Je nach Bedarf kann das bedeuten:
Teilzeit-Varianten im Überblick:
- 4 von 7 Diensten pro Blockwoche, danach 7 Tage frei
- 2 Wochenrhythmen mit geringerer Tagesarbeitszeit (z. B. 6 Stunden statt 10)
- Flexible Diensttage nachnachte Wunschmodell, eingebettet in das 7/7-System
Vorteile für Teilzeitkräfte:
- Mehr Planbarkeit trotz reduziertem Pensum
- Strukturierter Alltag mit langfristig freier Woche
- Integration in feste Teams bleibt erhalten
Wichtig ist, dass Teilzeitkräfte nicht automatisch aus dem System ausgeschlossen werden, sondern passende Varianten mitgedacht und angeboten werden.

Alternative Modelle: 3/3, 5/5, Wunschdienste & Hybridlösungen
Manche Einrichtungen nutzen die Grundidee des 7/7-Modells als Basis – und passen Rhythmus und Schichtlänge an. So entstehen hybride Arbeitszeitmodelle, die verschiedene Lebens- und Teamkonstellationen abbilden können.
Beispiele für Alternativen:
- 3/3-Modell: Drei Tage Dienst, drei Tage frei – z. B. für Berufsanfänger oder Eltern
- 5/5-Modell: Für Teams mit kürzeren Einsatzblöcken, aber klarer Rhythmik
- Wunschdienstmodelle: Pflegekräfte geben Präferenzen an, die softwaregestützt im Plan berücksichtigt werden
- Kombination mit Standarddienstplänen: Ein Teil des Teams arbeitet im 7/7-Modell, der andere in klassischen Früh-Spät-Systemen
Diese Varianten helfen, das Grundprinzip „Struktur + planbare Erholung“ auf unterschiedliche Teamkonstellationen zu übertragen.
Erfolgsbeispiel: So funktioniert das 7/7-Modell bei der DSG in der Praxis
In 2010 hat das Pflegewohnstift Hönow in Berlin‑Marzahn das 7‑Tage‑Dienst / 7‑Tage‑Frei‑Modell zunächst als dreimonatige Pilotierung eingeführt (Landkreis Osnabrück).
Aufgrund durchweg positiver Rückmeldungen wurde es dauerhaft etabliert und dient seitdem als Blaupause für Bauweisen und Digitalisierung innerhalb der Deutschen Seniorenstift Gesellschaft (DSG) mit mittlerweile 26 Einrichtungen (DSG).
Pflegewohnstift Hönow: Erfolgsfaktoren und Umsetzung im Team
Bevor das 7/7-Modell im Pflegewohnstift Hönow eingeführt wurde, arbeiteten die Pflegekräfte im klassischen Schichtsystem: 5,5 Tage pro Woche, mit häufigem Einspringen und wechselnden Schichten. Die Belastung war hoch, die Unzufriedenheit wuchs. Eine interne Umfrage und mehrere Workshops machten deutlich: Das Team wünschte sich mehr Planbarkeit, weniger Schichtchaos und eine bessere Balance zwischen Arbeit und Privatleben.
Das 7/7-Arbeitszeitmodell setzte genau hier an. Die lange Tagesstruktur reduziert Schichtwechsel und sorgt für mehr Ruhe in den Abläufen. Da die Mittagsübergabe entfällt, bleibt mehr Personal gleichzeitig im Dienst. Das stärkt die Teamarbeit und verbessert die Versorgungskontinuität.
Begleitet wurde die Einführung durch einen 24-seitigen Leitfaden. Dieser beschreibt alle relevanten Prozesse – von der Vorbereitung über die Organisation der Teams bis zur rechtssicheren Dienstplanung. Auch andere DSG-Einrichtungen nutzen ihn inzwischen als Vorlage für die Einführung des Modells.
Einführung Schritt für Schritt: Vom Testlauf zur Dauerlösung
Die Einführung des 7/7-Arbeitszeitmodells im Pflegewohnstift Hönow erfolgte nicht top-down, sondern wurde bewusst partizipativ und praxisnah gestaltet. Ziel war es, Mitarbeitende frühzeitig einzubinden, Bedenken ernst zu nehmen und das Modell im echten Pflegealltag zu testen.
-
Phase: Information und Beteiligung
Zunächst wurde das Modell in Dienstbesprechungen, Teamrunden und einem gezielten Kick-off vorgestellt. Die Leitungen informierten transparent über den geplanten Ablauf, Hintergründe und Ziele. Es wurde von Anfang an klar kommuniziert: Die Einführung erfolgt nur, wenn der Testlauf überzeugt.
-
Phase: Freiwilliger Testlauf über drei Monate
In einer ausgewählten Wohngruppe startete ein dreimonatiger Probelauf. Die Teilnahme war freiwillig. Die Teilnehmenden erhielten feste Dienstpläne nach dem 7/7-Prinzip: sieben Tage Dienst (10 Stunden netto + 2 Stunden Pause), sieben Tage frei. Parallel wurde dokumentiert, wie sich das Modell auf Dienstübergaben, Belastung, Teamprozesse und Bewohnerreaktionen auswirkt.
-
Phase: Auswertung & Reflexion
Während und nach dem Testlauf wurden:
- Erfahrungsberichte gesammelt (z. B. über Tagebuchformate)
- anonyme Befragungen durchgeführt
- Feedbackgespräche mit den Teams organisiert
- Daten zur Pflegequalität, Fehlzeiten und Übergabestruktur ausgewertet
Auch Herausforderungen wurden offen angesprochen – etwa organisatorische Fragen zur Pausengestaltung oder Bedenken hinsichtlich der Familienfreundlichkeit.
-
Phase: Anpassung & Optimierung
Auf Basis des gesammelten Feedbacks wurden gezielt Anpassungen vorgenommen:
- Einführung eines Admin-Tages zur Erholung nach dem Dienstblock
- Anpassung der Pausenregelung bei besonders belastenden Einsätzen
- Flexiblere Lösungen für Eltern und Alleinerziehende (z. B. durch Hybridmodelle)
-
Phase: Entscheidung zur Einführung
Nach Abschluss des Testzeitraums sprachen sich über 90 % der teilnehmenden Mitarbeitenden für eine dauerhafte Einführung des 7/7-Modells aus. Die positiven Effekte – insbesondere im Bereich Erholungsqualität, Teamstabilität, Dienstplanverlässlichkeit und Pflegeprozesskontinuität – überzeugten sowohl das Team als auch die Leitungsebene. Es folgte die verbindliche Aufnahme des Modells in die Dienstvereinbarung.
Wichtige Erkenntnisse aus dem Prozess:
- Die frühzeitige Einbindung der Pflegekräfte war entscheidend für die hohe Akzeptanz.
- Besonders Pflegekräfte mit klaren Freizeitbedürfnissen oder Pendelwegen profitierten stark.
- Anfangs skeptische Mitarbeitende – z. B. Alleinerziehende – zeigten sich später oft positiv überrascht.
- Die Kombination aus fester Struktur in der Dienstwoche und echter, planbarer Erholungszeit wurde als zentraler Gewinn empfunden.
- Viele wollten bereits nach kurzer Zeit nicht mehr ins alte Schichtsystem zurück.
Stimmen aus dem Alltag: Mitarbeitende berichten
Das 7/7-Arbeitszeitmodell hat im Pflegewohnstift Hönow nicht nur unter den Mitarbeitenden für positive Rückmeldungen gesorgt – auch Bewohnerinnen und Angehörige äußern sich anerkennend.
Die folgenden Stimmen zeigen, wie das Modell im Alltag erlebt wird – aus verschiedenen Perspektiven.
Pflegeassistentin, 30 Jahre, über ihren Arbeitsalltag im 7/7-Modell:
„Gerade dieser direkte Vergleich führt mir immer wieder vor Augen, wie gut ich es selbst getroffen habe. Ich habe einen gleichbleibenden Turnus und kann meine freie Zeit tatsächlich auch frei planen.“
Sie erlebt die intensive Dienstwoche als fordernd, aber strukturiert. Die freie Woche nutzt sie bewusst zur Erholung und stellt zugleich fest, wie sehr auch die Bewohner vom festen Personaleinsatz profitieren.
Bewohnerin und frühere Krankenschwester:
„Die Pflegekräfte wirken ausgeglichen, sind freundlich und hilfsbereit – und können sich durch die längere Anwesenheit an ihren Arbeitstagen intensiv um uns Bewohner kümmern. […] Mit dem Arbeitszeitmodell fahren also alle Beteiligten gut – durchaus nicht nur die Pflegekräfte.“
Ihre langjährige Berufserfahrung als Krankenschwester ermöglicht ihr einen besonderen Blick auf die Arbeitsatmosphäre. Sie spürt: Konstanz, weniger Personalwechsel und eine ruhige Grundhaltung wirken sich direkt positiv auf das Miteinander im Alltag aus.
Tochter einer Bewohnerin:
„Von meiner Mutter weiß ich, wie sehr sie es schätzt, dass es nicht ständig wechselnde Pflegekräfte gibt, sondern dass ihr die ganze Woche über der gleiche Ansprechpartner zur Verfügung steht. […] Meine Meinung: Das Arbeitszeitmodell der Einrichtung sollte ‚Schule machen‘.“
7/7-Modell einführen: Leitfaden für Pflegeeinrichtungen und Träger
Das 7/7-Modell bringt viele Vorteile. Doch seine Einführung erfordert Vorbereitung, Kommunikation und ein gutes Verständnis für die betrieblichen Rahmenbedingungen.
Wer das Modell erfolgreich umsetzen möchte, sollte nicht einfach Dienstzeiten umstellen, sondern gezielt in Teamprozesse, rechtliche Klarheit und Dienstplanstruktur investieren.
Vorbereitung: Mitarbeitende einbeziehen und Bedarfe klären
Der wichtigste Erfolgsfaktor bei der Einführung des 7/7-Modells ist die frühzeitige Beteiligung der Mitarbeitenden. Pflegekräfte müssen verstehen, was das Modell bedeutet, und mitreden können, bevor Entscheidungen getroffen werden.
Empfehlungen für die Vorbereitung:
- Informationen transparent im Team vorstellen (z. B. per Präsentation, Dienstbesprechung, Teamrunde)
- Vorteile, Ablauf und rechtliche Hintergründe verständlich erklären
- Fragen und Bedenken aktiv aufnehmen
- Anonyme Befragungen oder Einzelgespräche durchführen, um individuelle Bedürfnisse zu erfassen
- Bereitschaft zur Teilnahme abfragen – das Modell sollte freiwillig sein, zumindest in der Testphase
Tipp aus der Praxis: Eine offene Gesprächskultur von Anfang an schafft Vertrauen und erhöht die spätere Akzeptanz deutlich.
Pilotphase und rechtliche Rahmenbedingungen beachten
Vor der vollständigen Einführung empfiehlt sich eine Pilotphase von 2–3 Monaten in einem begrenzten Bereich oder mit einem freiwilligen Team. Das erlaubt praxisnahe Tests, schrittweises Lernen und rechtzeitige Korrekturen.
Wichtige Punkte in der Testphase:
- schriftliche Zustimmung der Teilnehmenden einholen
- begleitende Evaluation organisieren (z. B. durch Tagebuch, Interviews, Feedbackbögen)
- Pausenzeiten, Übergaben und Belastungsspitzen genau beobachten
- rechtliche Vorgaben aus dem Arbeitszeitgesetz einhalten:
- max. 10 Stunden Netto-Arbeitszeit pro Tag (§3 ArbZG)
- mind. 11 Stunden Ruhezeit (§5 ArbZG)
- Sonntagsruhe & Freizeitausgleich sicherstellen (§11 ArbZG)
- ggf. Betriebsrat, MAV oder Mitarbeitervertretung frühzeitig einbinden
- nach der Testphase über eine Betriebsvereinbarung rechtssichere Strukturen schaffen
Ein durchdachter Testlauf schafft Sicherheit, sowohl für Leitung als auch für Mitarbeitende.

Dienstplanung, Software und Kommunikation im Team
Das 7/7-Modell stellt andere Anforderungen an die Dienstplanung als klassische Schichtsysteme. Die Planung muss langfristig, transparent und klar gegliedert sein.
Organisatorische Anforderungen:
- Dienstpläne mindestens 6–12 Monate im Voraus erstellen
- Teams in feste Blöcke einteilen – keine spontanen Wechsel
- ausreichend Personal für Ausfallvertretungen (z. B. Urlaubs- oder Krankheitsvertretung) einplanen
- Pausenregelungen und Admin-Tage klar definieren
- idealerweise Software nutzen, die Blockdienste und Ausfallmanagement unterstützt
Das Modell kann nur funktionieren, wenn Organisation und Kommunikation Hand in Hand gehen. Gute Planung schafft Vertrauen und sorgt dafür, dass der Dienst auch bei Belastung stabil bleibt.
Gesetzliche Grundlagen zum 7/7-Arbeitszeitmodell in der Pflege
Das 7/7-Arbeitszeitmodell lässt sich in Deutschland rechtssicher umsetzen – unter der Voraussetzung, dass zentrale Vorschriften aus dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG), dem Tarifrecht und der Mitbestimmung eingehalten werden.
Was erlaubt das Arbeitszeitgesetz (ArbZG)?
Das Arbeitszeitgesetz steckt den Rahmen für zulässige Arbeitszeiten ab. Wichtig ist, dass das 7-Tage-Arbeit/7-Tage-frei-Modell die gesetzlichen Höchstgrenzen und Ruhevorschriften einhält. Dazu zählen unter anderem:
- Tägliche Höchstarbeitszeit: Grundsätzlich maximal 8 Stunden pro Werktag, ausnahmsweise bis zu 10 Stunden, sofern im Durchschnitt von 6 Monaten wieder 8 Stunden nicht überschritten werden (personio.de). Im 7/7-Modell werden pro Tag 10 Stunden Arbeitszeit (plus Pausen) angesetzt, was genau dieser Obergrenze entspricht. Eine Überschreitung auf über 10 Stunden ist laut ArbZG nur in besonderen Fällen zulässig (z. B. bei viel Bereitschaftsdienst und per Tarifregelung) – dies wird im 7/7-Modell jedoch vermieden, da die 2 zusätzlichen Stunden als Pausen gelten und keine Arbeitszeit darstellen (caritas-dienstgeber.de).
- Wöchentliche Arbeitszeit (Durchschnitt): Das ArbZG geht von 48 Stunden pro Woche als Höchstwert aus (6 Tage × 8 Std.; bei vorübergehender Verlängerung bis 60 Std./Woche im Ausgleich). Im 7/7-Modell arbeiten Pflegekräfte zwar in einer Arbeitswoche bis zu 70 Stunden (7 Tage × 10 Std.), haben aber die folgende Woche frei. Durchschnittlich ergibt das ~35 Stunden/Woche, was deutlich unter der zulässigen Grenze liegt. Die gesetzlichen Ausgleichszeiträume werden damit eingehalten, sodass keine Verstöße gegen das ArbZG auftreten.
- Tägliche Ruhezeit: Nach § 5 ArbZG sind mindestens 11 Stunden Ruhezeit nach Ende der täglichen Arbeitszeit vorgeschrieben. Im 7/7-Schichtsystem lässt sich das gewährleisten – z. B. Schichtende 19 Uhr und Folgeschichtbeginn 7 Uhr bedeuten 12 Stunden frei dazwischen. Verkürzungen der Ruhezeit sind in der Pflege nur eingeschränkt zulässig: Kliniken und Pflegeeinrichtungen dürfen die Ruhezeit einmal um bis zu 1 Stunde auf 10 Stunden verkürzen, wenn innerhalb von 4 Wochen an anderer Stelle eine Ruhezeit von 12 Stunden zum Ausgleich gewährt wird (komnet.nrw.de).
Eine noch stärkere Verkürzung (auf 9 Stunden) ist nur per Tarifvertrag bzw. darauf basierender Betriebsvereinbarung möglich, wenn es die Art der Arbeit erfordert und ein Ausgleich innerhalb eines definierten Zeitraums erfolg. In der Praxis des 7/7-Modells wird die Ruhezeit aber nicht unterschritten, da hier mit festen 12-Stunden-Abständen gearbeitet wird. - Sonntags- und Feiertagsruhe: Das Gesetz schützt grundsätzlich die arbeitsfreien Sonntage und staatlichen Feiertage (§ 9 ArbZG). Ausnahmen gibt es aber für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen (§ 10 ArbZG. Pflegekräfte dürfen an Sonn- und Feiertagen arbeiten, wenn dies betrieblich nötig ist. Allerdings muss für jeden gearbeiteten Sonntag innerhalb von 2 Wochen ein Ersatzruhetag gewährt werden. Ebenso ist für geleistete Feiertagsarbeit an einem Werktag innerhalb von 8 Wochen ein freier Ersatztag zu geben.
Das 7/7-Modell trägt dem Rechnung, da auf eine Arbeitswoche (in der ggf. ein Sonntag/Feiertag gearbeitet wird) unmittelbar eine freie Woche folgt, in der die notwendigen Ausgleichstage liegen.
Wichtig: Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen nach dem Gesetz beschäftigungsfrei sein. Mit einem 7/7-Rhythmus (jedem zweiten Sonntag frei) wird diese Vorgabe problemlos erfüllt.
Mitbestimmung durch Betriebsrat – worauf es bei der Einführung ankommt
Die Einführung eines 7/7-Arbeitszeitmodells erfordert nicht nur eine juristische Prüfung, sondern auch die Einbindung der Mitarbeitervertretung.
In deutschen Pflegeeinrichtungen bedeutet das: Betriebsrat (bei privat-kommunalen Trägern) oder Mitarbeitervertretung nach kirchlichem Arbeitsrecht (bei kirchlichen Trägern) haben ein gewichtiges Wort mitzureden.
- Dienstpläne sind mitbestimmungspflichtig: Gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sowie bei der Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage (inklusive Pausen. Praktisch bedeutet das: Die Pflegedienstleitung und der Träger müssen den Betriebsrat frühzeitig informieren und eine Betriebsvereinbarung über das 7/7-Modell abschließen. Gleiches gilt in Einrichtungen mit MAV – hier ist nach den Mitarbeitervertretungsgesetzen (z. B. MAVO der Caritas oder MVG-EKD) die Dienstplangestaltung ebenfalls mitbestimmungspflichtig (bund-verlag.de).
- Arbeitsvertragsregelungen beachten: Der Betriebsrat kann zwar die Verteilung der Arbeitszeit mitgestalten, nicht aber einseitig die Dauer der vertraglichen Arbeitszeit ändern (betriebsrat.de). Im 7/7-Modell ist zu bedenken, dass eine Vollzeitkraft über 14 Tage nur 70 Stunden leistet (entspricht 35 Stunden/Woche). Soll dies als Vollzeit gelten, braucht es ggf. tarifliche Grundlagen oder individuelle Vereinbarungen, da viele Tarifverträge 38,5 oder 40 Stunden/Woche als Vollzeit definieren. Hier ist es ratsam, die zuständige Gewerkschaft frühzeitig einzubeziehen, falls ein Tarifvertrag tangiert wird, um keine Tarifverstöße zu riskieren.

Fazit: Für wen lohnt sich das 7/7-Modell wirklich?
Das 7/7-Arbeitszeitmodell bietet sowohl Pflegekräften als auch Arbeitgebern eine attraktive Alternative zum klassischen Schichtsystem. Für Pflegekräfte bedeutet es planbare Freizeit, strukturierte Arbeitswochen und eine spürbare Verbesserung der Work-Life-Balance. Arbeitgeber profitieren von geringeren Ausfällen, höherer Zufriedenheit im Team und einer stärkeren Positionierung im Wettbewerb um qualifiziertes Personal.
Doch das Modell ist nicht für jede Lebenssituation oder Einrichtung pauschal geeignet. Entscheidend ist, es flexibel, mitarbeiterorientiert und rechtssicher umzusetzen. Besonders erfolgreich ist es dort, wo Pflegekräfte freiwillig teilnehmen und die Einführung sorgfältig begleitet wird.
Ob Pflegekraft oder Einrichtung – jetzt aktiv werden:
👤 Für Pflegekräfte: Du willst mehr Planbarkeit und Arbeitgeber, die dich verstehen?
Tausch dich kostenlos mit anderen Pflegekräften aus und lass dich finden: Care Rockets – Pflegekräfte
🏢 Für Arbeitgeber: Sie möchten moderne Arbeitszeitmodelle aktiv kommunizieren?
Dann erstellen Sie jetzt Ihr kostenloses Unternehmensprofil: Care Rockets Unternehmensprofil anlegen
.webp)

%20aktuell.png?width=300&height=300&name=Podcast%20Cover%20(Close%20Up)%20aktuell.png)