Innovative Arbeitszeitmodelle in der Pflege
In diesem Ratgeber erfahren Sie, welche modernen Arbeitszeitmodelle es in der Pflege gibt – von der 4-Tage-Woche über das 7/7-Modell bis hin zu flexiblen Wunschdiensten. Wir zeigen Ihnen, welche Chancen diese Modelle für Personalbindung und Mitarbeitermotivation bieten.
Pflegepersonal gesucht? Erstellen Sie jetzt Ihr kostenloses Unternehmensprofil auf Care Rockets.
%20(1).png?width=1250&height=1250&name=hero-arbeitszeitmodelle%20(1)%20(1).png)
Die Pflegebranche steht unter Druck. Der anhaltende Fachkräftemangel, steigende Krankheitsquoten und die veränderten Erwartungen jüngerer Generationen stellen viele Pflegeeinrichtungen vor zentrale Fragen:
- Wie können wir als Arbeitgeber attraktiv bleiben?
- Wie gewinnen und binden wir Pflegekräfte langfristig?
Eine der wirksamsten Antworten liegt in einem oft unterschätzten Hebel – der Gestaltung der Arbeitszeit.
Inhaltsverzeichnis
- Warum moderne Arbeitszeitmodelle entscheidend sind
- Der Status Quo in Pflegeeinrichtungen
- Welche Arbeitszeitmodelle in der Pflege gibt es?
- Welches Modell passt zu welcher Einrichtung?
- Employer Branding mit modernen Arbeitszeitmodellen gezielt stärken
- Was Pflegeeinrichtungen beim Einführen neuer Arbeitszeitmodelle beachten müssen
- Fazit
Warum moderne Arbeitszeitmodelle entscheidend sind
Flexible Arbeitszeit ist heute einer der wichtigsten Faktoren für Pflegekräfte – oft noch vor dem Gehalt. Für Arbeitgeber bieten moderne Modelle nicht nur Entlastung, sondern auch echte Vorteile im Recruiting und in der Mitarbeiterbindung.
Pflegekräfte erwarten mehr Flexibilität – nicht nur mehr Geld
Laut einer Analyse des Instituts Arbeit und Technik (IAT) ist für viele Pflegekräfte die Arbeitszeitgestaltung inzwischen relevanter als das Gehalt (siehe auch Care Rockets Umfrage).
Der Wunsch nach planbaren Arbeitszeiten (Dienstplansicherheit), weniger geteilten Diensten und längeren Erholungsphasen ist besonders bei der sogenannten Generation Z ausgeprägt. Arbeitgeber, die hier aktiv werden, verschaffen sich einen klaren Wettbewerbsvorteil – auch gegenüber Zeitarbeitsfirmen.
Eine Allensbach-Umfrage im Auftrag der Pflegekammer NRW (2024) bestätigt dieses Bild: Knapp 50 % der teilzeitbeschäftigten Pflegekräfte unter 30 Jahren wären bereit, mehr Stunden zu arbeiten – sofern flexible Modelle wie Sabbaticals oder Wahlarbeitszeit eingeführt würden. Auch bei älteren Altersgruppen zeigt sich noch deutliches Potenzial. (Quelle: Pflegekammer NRW).
93 % der Pflegekräfte glauben laut TK-Umfrage (Juli 2024), dass attraktive Arbeitszeitmodelle den Personalbestand in der Pflege deutlich erhöhen könnten (Quelle: sueddeutsche.de).
Arbeitszeitmodelle als strategisches Instrument gegen den Fachkräftemangel
Flexible Modelle wie Wahlarbeitszeit, 4-Tage-Woche oder Pflegepools sind weit mehr als bloße Organisationsformen: Sie sind Employer-Branding-Instrumente und Bindungstools zugleich. Einrichtungen, die solche Modelle anbieten, berichten von:
- Mehr qualifizierten Bewerbungen
- Sinkenden Fehlzeiten
- Geringerer Fluktuation
- Höherer Zufriedenheit im Team
Beispiel: Die DRK-Sozialstation Seelze führte ein 4-Tage-Woche-Modell ein und verzeichnete eine deutliche Zunahme an Bewerbungen, insbesondere von Teilzeitkräften mit Familienpflichten.
Auch wirtschaftlich sinnvoll: Weniger Ausfälle, bessere Planbarkeit
Arbeitszeitmodelle wie das 7/7-Modell oder der Flexpool führen zu weniger Überstunden, geringerer Krankheitsquote und effizienterer Personalsteuerung, wie das Beispiel der Charité Berlin zeigt. Der Pflegepool dort ermöglicht eine bedarfsgerechte Personalabdeckung und bietet gleichzeitig maximale Planbarkeit für die Mitarbeitenden.
Der Status Quo in Pflegeeinrichtungen: Typische Modelle & ihre Herausforderungen
Viele Pflegeeinrichtungen arbeiten noch immer mit traditionellen Schichtmodellen, die zwar etabliert sind, aber zunehmend an ihre Grenzen stoßen. In diesem Abschnitt zeigen wir, welche Arbeitszeitformen aktuell dominieren und warum sie für viele Pflegekräfte nicht mehr zeitgemäß sind.
Die E-Mail-Adresse ist bereits vergeben. Andere E-Mail wählen oder anmelden
3-Schicht-System: Standard mit steigenden Ausfällen
In stationären Einrichtungen ist das klassische Früh-, Spät- und Nachtdienst-Modell weiterhin üblich. Es bietet organisatorische Stabilität, sorgt aber zunehmend für gesundheitliche Belastung, unregelmäßige Erholung und hohe Fehlzeiten. Nachtdienste werden entweder rotiert oder fest vergeben (Dauernachtwachen). Pflegekräfte klagen über Erschöpfung und mangelnde Planbarkeit. Besonders die jüngeren Generationen lehnen das starre Schichtprinzip zunehmend ab.

Teildienste: ineffizient und demotivierend
Insbesondere in der ambulanten Pflege oder in Einrichtungen mit Tagespflege kommt es häufig zu geteilten Diensten – etwa einem Frühdienst von 7 bis 11 Uhr und einem Spätdienst ab 16 Uhr. Das führt zu:
- Unproduktive Pausen mitten am Tag, die weder zur Erholung noch für private Erledigungen sinnvoll nutzbar sind
- Lange Abwesenheit vom Zuhause bei vergleichsweise kurzer Nettoarbeitszeit
- Hohe Unzufriedenheit, da das Gefühl entsteht, den ganzen Tag „verplant“ zu sein
- Abwanderung in die Zeitarbeit, wo durchgehende Dienste oft besser planbar und besser bezahlt sind
Aber: Für manche Mitarbeitende können Teildienste durchaus passen. Etwa, wenn sie in der langen Mittagspause Kinder betreuen oder Angehörige versorgen. Auch bei guter Tourenplanung, kurzen Anfahrtswegen und frei gewähltem Einsatzmodell kann die Belastung deutlich reduziert werden (Quelle: baua.de).
Teilzeit & Wunschpräferenzen: Komplexe Planung, wenig Puffer
Ein Großteil der Pflegekräfte arbeitet in Teilzeit, häufig aus Selbstschutz. Gleichzeitig äußern viele feste Wünsche („nur Frühdienst“, „kein Wochenende“). Für Arbeitgeber entsteht so ein Planungslabyrinth: Schichtpläne werden zur Dauerherausforderung – besonders bei dünner Personaldecke.
Auswirkungen auf Fachkräftemangel, Burnout und Arbeitgeberattraktivität
Starre Arbeitszeitmodelle wirken sich direkt auf Gesundheit, Motivation und Verbleib im Beruf aus. Belastende Schichtsysteme erhöhen das Burnout-Risiko, fördern Frühverrentung und schrecken potenzielle Bewerber:innen ab.
Burnout-Risiko steigt
Laut der Pflegestudie 2.0 der BARMER fühlen sich über 62 % der Pflegekräfte regelmäßig erschöpft. Wesentliche Ursache: belastende Dienstzeiten ohne ausreichende Erholungsphasen.
Fluktuation & Frühverrentung
Pflegekräfte steigen häufig vor dem gesetzlichen Rentenalter aus – meist schon zwischen 60 und 64 Jahren. Grund sind vor allem körperliche Belastung, psychischer Druck und gesundheitliche Probleme. Nur ein Bruchteil will bis 67 arbeiten: Laut lidA-Studie planen das nur 7 % der Krankenpflege- und 15 % der Altenpflegekräfte.
Der Barmer-Pflegereport zeigt zudem: Der Pflegeberuf ist so kraftraubend, dass überproportional viele Beschäftigte nicht bis zur Rente durchhielten. Der Anteil der Pflegekräfte mit einer Erwerbsminderungsrente ist bis zu doppelt so hoch wie in sonstigen Berufen.
Unattraktives Employer Branding
Moderne Pflegekräfte – besonders aus der Generation Z – erwarten flexible Zeitmodelle. Einrichtungen, die weiterhin nur klassische Modelle bieten, wirken veraltet – was sich negativ auf Bewerbungsraten und Image auswirkt.
Überblick: Welche Arbeitszeitmodelle in der Pflege gibt es?
Die Anforderungen in der Pflege sind vielfältig und genauso unterschiedlich sind die Möglichkeiten, Arbeitszeiten flexibel zu gestalten.
Hier stellen wir bewährte und neue Modelle vor, inklusive Praxisbeispielen und Studien, die zeigen, was wirklich funktioniert.

Klassisches Schichtsystem (3-Schicht-Modell)
Das klassische 3-Schicht-System ist nach wie vor das am weitesten verbreitete Arbeitszeitmodell in stationären Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Es umfasst:
- Frühdienst (z. B. 6:00–14:00 Uhr)
- Spätdienst (z. B. 14:00–22:00 Uhr)
- Nachtdienst (z. B. 22:00–6:00 Uhr)
Vorteile für Arbeitgeber
Trotz aller Herausforderungen bietet das klassische Schichtmodell einige betriebliche Vorteile:
- Klare Planbarkeit: Standardisierte Dienstzeiten und eine etablierte Personalstruktur ermöglichen vorausschauende Einsatzpläne.
- Stabile Abläufe: Die Versorgung ist rund um die Uhr gesichert – auch in Notfallsituationen.
- Klar definierte Übergaben zwischen Früh-, Spät- und Nachtdienst fördern Verlässlichkeit in der Kommunikation.
Nachteile & Risiken für Arbeitgeber
In der heutigen Pflegepraxis stößt dieses Modell jedoch an seine Grenzen, insbesondere im Hinblick auf Personalbindung und Gesundheit der Beschäftigten:
- Physische und psychische Belastung durch häufige Schichtwechsel und unterbrochene Schlafzyklen
- Hohe Krankheitsquoten bei Wechselschichtkräften: Laut Daten der BGW ist die Fehlzeitenquote bei Pflegekräften mit Schichtarbeit signifikant höher als im Branchendurchschnitt.
- Unattraktiv für Bewerber:innen: Besonders jüngere Pflegekräfte lehnen starre Schichtpläne zunehmend ab, was die Personalgewinnung erschwert.
- Vereinbarkeitsprobleme: Späte Dienste und spontane Einsätze kollidieren mit familiären Verpflichtungen – ein häufiger Kündigungsgrund bei Pflegekräften.
Studienbeleg: Belastung durch Wechselschicht
Der Barmer-Pflegereport hat gezeigt: Über 60 % der befragten Pflegekräfte gaben an, regelmäßig körperlich und emotional erschöpft zu sein. Ein deutlicher Zusammenhang bestand mit unregelmäßiger Schichtarbeit und fehlenden Erholungsphasen.
Auch die BGW berichtet regelmäßig über eine überdurchschnittliche Burnout- und Ausfallquote bei Schichtarbeitenden, insbesondere in stationären Settings (Quelle: BGW-Online).
Fazit für Arbeitgeber
Das klassische Schichtmodell funktioniert organisatorisch, aber es überlastet das Personal und wird von vielen Pflegekräften nicht mehr akzeptiert. Einrichtungen, die ausschließlich auf diese Struktur setzen, haben es schwerer, neue Fachkräfte zu gewinnen und bestehende zu halten.
Wenn Sie dieses Modell einsetzen, sollten Sie daher prüfen, ob es ergänzt oder flexibilisiert werden kann, z. B. durch Freiwilligkeit bei Nachtdiensten, Fixierung einzelner Schichten oder Kombination mit Wunschdienstmodellen.

Gleitzeit und Funktionszeit in der Pflege
Gleitzeit und Funktionszeitmodelle gelten in vielen Branchen längst als Standard. In der Pflege sind sie bislang vor allem in Verwaltungsbereichen oder unterstützenden Diensten verbreitet.
Was ist Gleitzeit in der Pflege?
Gleitzeit erlaubt es Mitarbeitenden, den Beginn und das Ende ihrer täglichen Arbeitszeit flexibel zu wählen, innerhalb eines vorgegebenen Rahmens. Typischer Aufbau:
- Kernarbeitszeit: z. B. 9:00–14:00 Uhr
- Gleitphase: z. B. Arbeitsbeginn zwischen 7:00–9:00 Uhr, Arbeitsende zwischen 14:00–18:00 Uhr
- Stundenerfassung über ein Zeiterfassungssystem oder Vertrauensarbeitszeitmodell
In Pflegeeinrichtungen ist dieses Modell für nicht pflegerisches Personal bereits üblich: Verwaltung, Sozialdienst, Haustechnik, Hauswirtschaft oder Therapieplanung. Für pflegerisches Personal ist Gleitzeit nur begrenzt einsetzbar, kann aber in Kombination mit Fixdiensten oder Wunschdiensten neue Perspektiven eröffnen.
Was ist Funktionszeit?
Die sogenannte Funktionszeit ist eine spezielle Form der Gleitzeit – sie basiert auf festgelegten Betriebszeiten, innerhalb derer der Arbeitgeber die Arbeitszeit flexibel steuern kann. Die Mitarbeiter:innen müssen im Gegensatz zur Gleitzeit nicht selbst planen, sondern arbeiten nach betrieblich geplanten Blöcken, die auf Flexibilität und Bedarfssteuerung abzielen.
Beispiel aus der Pflege: Eine stationäre Einrichtung plant die Frühschicht nicht starr von 6:00 bis 14:00 Uhr, sondern bietet mehrere Startzeiten (z. B. 6:00, 7:00, 8:00 Uhr), um individuelle Präferenzen zu berücksichtigen und gleichzeitig die Personalabdeckung an den tatsächlichen Bedarf (Spitzenzeiten) anzupassen.
Vorteile für Arbeitgeber
- Verbesserte Planbarkeit für unterstützende Bereiche (Verwaltung, Tagespflege).
- Mehr Motivation und Bindung bei Mitarbeitenden durch bessere Vereinbarkeit mit Privatleben.
- Gesteuerte Personalsteuerung in Randzeiten, wenn strategisch geplant
- Positive Wirkung auf das Employer Branding – insbesondere bei jüngeren Bewerber:innen.
Herausforderungen & Einschränkungen
- In der pflegerischen Versorgung ist Gleitzeit nur begrenzt möglich, da die Versorgung zu festen Zeiten sichergestellt sein muss.
- Die Koordination im Team wird komplexer, wenn viele individuelle Startzeiten bestehen.
- Rechtssichere Zeiterfassungssysteme und ggf. Software müssen eingeführt werden.
- Kernarbeitszeiten müssen definiert werden, sonst droht Unterbesetzung.
Studien & Praxisbeispiele zu Gleitzeit in der Pflege
Zwar gibt es derzeit wenig Forschung speziell zur Gleitzeit in der Pflege, jedoch zeigen die positiven Effekte in angrenzenden Funktionen: Flexible Arbeitszeiten sind auch in Pflegeeinrichtungen machbar und wirkungsvoll.
Fazit für Arbeitgeber
Gleitzeit und Funktionszeit sind unterschätzte Stellschrauben, um Pflegeeinrichtungen intern flexibler und attraktiver zu machen – auch wenn sie nicht flächendeckend auf pflegerisches Personal anwendbar sind.
Wer Gleitzeit für unterstützende Bereiche nutzt und Funktionszeit strategisch plant, sendet ein deutliches Signal: Hier denken wir Pflegearbeit neu und passen uns der Lebensrealität unserer Mitarbeitenden an.
Wahlarbeitszeit & Wunschdienstplanung
Das Modell der Wahlarbeitszeit (siehe wikipedia) basiert auf einem einfachen Prinzip: Pflegekräfte planen ihre Dienste im Rahmen definierter Zeitfenster, die der Arbeitgeber vorgibt, modular und selbstbestimmt. Damit wird das starre Dienstplansystem aufgebrochen und durch ein kooperatives Planungsmodell ersetzt.
Wie funktioniert Wahlarbeitszeit?
Der Arbeitgeber definiert bestimmte Dienstmodule – z. B.:
- Frühmodul: 6:00–12:00 Uhr
- Mittagsmodul: 12:00–18:00 Uhr
- Spätmodul: 18:00–22:00 Uhr
Die Pflegekräfte wählen monatlich oder quartalsweise, welche Blöcke sie übernehmen möchten. Dabei gilt: Solange alle Dienste abgedeckt werden, haben die Mitarbeitenden maximale Gestaltungsfreiheit. Häufig wird das System durch eine digitale Selbstplanungssoftware unterstützt.
Vorteile für Arbeitgeber
- Höhere Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden durch Mitbestimmung.
- Bessere Teilzeitintegration – Mitarbeitende mit Familie oder anderen Verpflichtungen finden passende Zeitslots.
- Flexible Dienstabdeckung, besonders in Randzeiten oder Stoßzeiten
- Weniger kurzfristige Ausfälle, weil Pflegekräfte selbst gewählte Dienste verlässlicher antreten.
Herausforderungen in der Praxis
- Unbeliebte Zeitfenster (z. B. Wochenenden, Spätabende) bleiben oft als Letztes übrig.
- Hoher Koordinationsaufwand, besonders bei fehlender Software
- Nicht für jedes Team geeignet – besonders kleine Stationen benötigen hohe Abstimmung und Ausfallsicherheit
- Gerechtigkeitsempfinden im Team muss aktiv moderiert werden (z. B. durch Rotation unbeliebter Dienste).
Praxisbeispiel: Buurtzorg – Wunschdienst als Teamprinzip
Das niederländische Pflegeunternehmen Buurtzorg zeigt, wie weit Wunschdienstplanung gehen kann: Dort organisieren kleine, selbstverwaltete Pflegeteams ihre kompletten Einsatzzeiten selbst – ohne zentrale Dienstpläne, aber mit klaren Rahmenvorgaben und digitalen Tools.
Pflegekräfte sprechen sich intern ab, übernehmen Verantwortung füreinander und passen die Dienste flexibel an persönliche Lebenssituationen an. Die Folge:
- Höchste Mitarbeiterzufriedenheit im niederländischen Gesundheitswesen
- Deutlich geringere Krankheitsquoten als bei herkömmlichen Trägern
- Starke Identifikation mit dem Team – trotz hoher Autonomie

Vier-Tage-Woche (komprimiert oder reduziert)
Die Vier-Tage-Woche gilt aktuell als eines der spannendsten Arbeitszeitmodelle – auch in der Pflege. In Deutschland wurde sie bereits in zahlreichen Pflegeeinrichtungen getestet. Ziel: mehr Erholung, höhere Arbeitgeberattraktivität und bessere Vereinbarkeit.
Dabei gibt es zwei gängige Varianten:
- Komprimierte Vollzeit
→ Mitarbeitende arbeiten weiterhin z. B. 38,5 Stunden, verteilt auf vier statt fünf Tage (z. B. viermal 9,6 Stunden pro Woche)
- Reduzierte Vollzeit (100-80-100-Modell)
→ 100 % Gehalt bei 80 % Arbeitszeit – bei 100 % Produktivität (z. B. viermal 8 Stunden statt fünfmal 8 Stunden)
Vorteile für Arbeitgeber
- Höhere Arbeitgeberattraktivität: Einrichtungen mit 4-Tage-Modell erhalten deutlich mehr Bewerbungen
- Weniger Fehlzeiten und Krankmeldungen durch längere Erholungsphasen
- Produktivitätssteigerung: Mitarbeitende fühlen sich ausgeruhter und motivierter
- Stärkere Mitarbeiterbindung: Besonders junge Pflegekräfte schätzen das Zeitmodell
Herausforderungen in der Umsetzung
- Lange Schichten: Komprimierte Modelle bedeuten bis zu 10-Stunden-Tage → Ermüdung, höhere Pausenplanung nötig
- Rechtliche Grenzen: Laut §3 ArbZG dürfen i. d. R. nicht mehr als 10 Stunden pro Tag gearbeitet werden
- Dienstplanaufwand: Mischmodelle (4 und 5 Tage parallel) erfordern neue Planungssysteme
- Kostensteigerung bei reduzierten Wochenstunden: Bei vollem Lohnausgleich entstehen Mehrkosten
Praxisbeispiel 1: DRK Sozialstation Seelze
Seit Juli 2023 testet die DRK-Sozialstation Seelze in Niedersachsen die Vier-Tage-Woche in der ambulanten Pflege. Erste Ergebnisse:
- Gezielter Bewerberzuwachs – Pflegekräfte meldeten sich explizit wegen des 4-Tage-Modells
- Positive Rückmeldungen im Team: Weniger Stress, besser planbares Privatleben
- Wirtschaftliche Herausforderung: Höhere Kosten, da mehr Personalstunden nötig wurden
(Quelle: dmrz.de – Erfahrungsbericht DRK Seelze)
Praxisbeispiel 2: Klinikum Bielefeld & Klinikum Siegen
Beide Häuser haben ab Sommer 2023 die 4-Tage-Woche in einzelnen Stationen getestet, mit folgenden Erkenntnissen:
- Verlängerte Schichten (9 Stunden inkl. Pause) führten zu wertvollen Überlappungszeiten.
- In den Stoßzeiten am Nachmittag waren mehr Pflegekräfte gleichzeitig anwesend.
- Übergaben verliefen effizienter und die Patientenzufriedenheit stieg.
(Quelle: Klinikum Bielefeld, Klinikum Siegen)
Henrik van Gellekom, Pflegedienstleiter im Klinikum Bielefeld, berichtet uns in einem Interview ausführlich über seine Erfahrungen mit der 4-Tage-Woche in der Pflege.
Zum Interview: Erfahrung Vier-Tage-Woche in der Pflege: Ein Blick ins Klinikum Bielefeld
Fazit für Arbeitgeber
Die Vier-Tage-Woche ist kein reines Marketingversprechen, sondern ein ernst zu nehmendes Modell zur Mitarbeiterbindung und Rekrutierung, wenn sie strategisch geplant und rechtssicher umgesetzt wird.
7/7-Modell & Blockdienstmodelle
Das sogenannte 7/7-Modell (auch Blockdienstmodell genannt) basiert auf einem einfachen Prinzip: Pflegekräfte arbeiten sieben Tage am Stück – meist mit 10- bis 12-Stunden-Schichten – und haben danach sieben Tage frei. Die Wochenarbeitszeit wird im Zweiwochenrhythmus ausgeglichen. Dieses Modell erfreut sich zunehmender Beliebtheit, vor allem in der stationären Pflege.
Aufbau & Varianten des Modells
- Standardform: 7 Arbeitstage à ~ 10 Stunden, danach 7 Tage frei → Ø 35 Std./Woche
- Keine Mittagsübergaben: die Tagesverantwortung liegt eine Woche lang beim selben Team
- Teilzeitvariante: z. B. 4 Tage arbeiten, 10 Tage frei (entspricht 50 % Stelle)
- Skandinavische Alternative: 3 Tage arbeiten, 3 Tage frei (3 + 3-Modell)
Oft wird das Modell durch Pausenregelungen (z. B. 2 Stunden Pause pro Schicht) ergänzt, um die gesetzlichen Höchstarbeitszeiten einzuhalten.
Vorteile für Arbeitgeber
- Weniger Schichtübergaben → geringerer Informationsverlust
- Gleichbleibende Ansprechpartner → höhere Versorgungsqualität und Bewohnerzufriedenheit
- Reduzierte Krankheitsquote durch längere Erholungsphasen
- Dienstplanentlastung: Rahmenpläne, kaum spontane Einspringer notwendig
- Stärkere Mitarbeiterbindung – besonders bei Pendlern oder Pflegekräften ohne Betreuungspflichten
Herausforderungen in der Umsetzung
- Hohe tägliche Belastung über 10–12 Stunden
- Nicht für jede Lebenssituation geeignet (z. B. bei Alleinerziehenden oder pflegenden Angehörigen)
- Einführungsphase braucht Begleitung: DSG berichtet von bis zu 12 Wochen Gewöhnungszeit
- Teamstruktur kann sich verändern, wenn unterschiedliche Arbeitsmodelle parallel bestehen
- Rechtliche Grenzen: Ruhezeiten und Höchstarbeitszeiten müssen eingehalten werden (z. B. §3 ArbZG)
Praxisbeispiel: DSG Pflegewohnstift Hönow
Das DSG-Pflegewohnstift Hönow führte das 7/7-Modell zunächst testweise ein – heute ist es dort Standard. Einige Kernergebnisse:
- Deutliche Reduktion der Krankheitstage nach Einführung des Modells
- Pflegekräfte entwickeln eigeninitiativ Ideen für den Alltag, etwa Ausflüge oder gemeinsame Mahlzeiten mit Bewohnern
- Mehr Zeit für Pflegedokumentation und individuelle Zuwendung
- Bewohner und Angehörige berichten von mehr Ruhe und Verlässlichkeit
- Hohe Bewerberresonanz: Die 7/7-Kampagne löste laut Leitung einen „regelrechten Run“ auf die Einrichtung aus
Internationaler Vergleich: Skandinavisches 3 + 3-Modell mit nachweislich weniger Krankentagen
In Schweden wurde im Rahmen eines landesweiten Modellprojekts das sogenannte 3 + 3-Modell eingeführt:Pflegekräfte arbeiten drei Tage am Stück (à 8 Stunden) und haben anschließend drei Tage frei – ein Modell, das sowohl stationär als auch ambulant erprobt wurde.
Die Ergebnisse sind bemerkenswert:
- Krankheitsquote sank um bis zu 40 %
- Fluktuation ging deutlich zurück
- Pflegekräfte berichteten von mehr Erholung, besserer Teamatmosphäre und höherer Arbeitszufriedenheit
- Die Patient:innen profitierten von mehr Verlässlichkeit und weniger Personalwechseln.
(Quelle: Sabine Richter, Gesundheitskongress Hamburg 2016 – PDF)
Auch in Norwegen wurden ähnliche Modelle in Pflegeeinrichtungen getestet – teils mit Arbeitswochen von 30 bis 32 Stunden bei vollem Gehalt.
50/50-Modell & Jahresarbeitszeit: Saisonale Vollzeit mit freier Auszeit
Das 50/50-Modell ist ein noch seltenes, aber zunehmend diskutiertes Arbeitszeitmodell, das besonders bei jüngeren Pflegekräften, Berufseinsteiger:innen und Pendelnden auf Interesse stößt.
Es basiert auf dem Prinzip: Ein halbes Jahr Vollzeit arbeiten – ein halbes Jahr frei (mit oder ohne Gehaltsausgleich).
Was bedeutet das konkret?
- Pflegekräfte arbeiten z. B. sechs Monate durchgängig in Vollzeit
- Danach: sechs Monate Auszeit – für Reisen, Fortbildung, Familie oder Erholung
- Die Vergütung erfolgt auf Basis eines durchschnittlichen Monatseinkommens über das Jahr verteilt.
- Häufig gekoppelt mit einem Jahresarbeitszeitkonto (Arbeitsstunden werden auf ein Jahr gerechnet und flexibel eingesetzt)
Vorteile für Arbeitgeber
- Hohe Attraktivität für jüngere Zielgruppen (Generation Z, Umsteiger:innen)
- Planbare Einsätze in saisonal stark frequentierten Zeiträumen (z. B. Winter im Krankenhaus, Sommer in der Kurzzeitpflege)
- Weniger spontane Ausfälle, da Mitarbeitende auf ihre Auszeit hinarbeiten
- Stärkere emotionale Bindung, wenn das Modell freiwillig und individuell gestaltet wird
Herausforderungen
- Personalbedarf muss doppelt geplant werden → hohe Anforderungen an Personalmanagement
- Rechtlich anspruchsvoll (Tarifvertrag, Arbeitszeitgesetz, Lohnfortzahlung bei Krankheit)
- Nicht für alle Lebensphasen geeignet: z. B. für Eltern kleiner Kinder oder Alleinerziehende
- Erhöhter Verwaltungsaufwand bei der Stundenverteilung und Abrechnung
Praxisbeispiel: Klinikum Leverkusen – saisonale Jahresarbeitszeit in der Praxis
Das Klinikum Leverkusen hat Jahresarbeitszeitmodelle mit saisonalen Einsätzen eingeführt – insbesondere in der Pädiatrie und der zentralen Notaufnahme. Pflegekräfte arbeiten dort in intensiven, abgestimmten Zeitblöcken, um gezielt in Phasen mit hohem Patientenaufkommen (z. B. Grippewelle im Winter) zur Verfügung zu stehen.
- Das Modell basiert auf freiwilliger Beteiligung.
- Ausgleichszeiten werden gesammelt oder in längeren Zeiträumen genommen.
- In Einzelfällen konnten so auch Fortbildungsblöcke, Elternzeitverlängerungen oder Auslandsaufenthalte ermöglicht werden.
Fazit für Arbeitgeber
Das 50/50-Modell ist nicht für alle – aber für die richtigen Pflegekräfte eine echte Chance, Arbeit und Leben zeitlich neu zu gestalten.
Wichtig bei der Einführung:
- Nur auf freiwilliger Basis anbieten
- Jahresarbeitszeitkonto & klare Dienstplanzyklen einführen
- Personalengpässe durch Springer- oder Flex-Pools abfedern
- Attraktiv kommunizieren (z. B. für Sabbatical, Pflegezeit, Studienvorbereitung)
Flex-Pool & Springerkräfte: Selbstbestimmt arbeiten, flexibel planen
Flex-Pools (auch Pflegepools oder Springerpools genannt) sind flexible Einsatzteams, die nicht fest einer Station oder Tour zugeordnet sind, sondern einrichtungsübergreifend oder stationsübergreifend einspringen, wenn Personal fehlt. Der große Unterschied zur klassischen Springerrolle: Pflegekräfte im Pool planen ihre Dienste weitgehend selbst – auf Wunsch und zu ihren bevorzugten Zeiten.
Wie funktioniert das Flex-Pool-Modell?
- Mitarbeitende im Pool melden verfügbare Zeitfenster, z. B. über App oder Online-Dienstplan.
- Der Arbeitgeber gleicht diese mit Bedarfsspitzen, Krankheitsausfällen oder Urlaubsvertretungen ab.
- Pflegekräfte werden dann zielgerichtet und freiwillig eingesetzt – bei voller tariflicher Absicherung.
Flex-Pools können sowohl innerhalb einer Einrichtung (z. B. Krankenhausstationen) als auch trägerübergreifend (z. B. in Pflegenetzwerken oder Verbünden) funktionieren.
Vorteile für Arbeitgeber
- Weniger kurzfristiges Einspringen in den Stammbereichen
- Hohe Dienstplanflexibilität bei Krankheit, Urlaub oder Engpässen
- Attraktivität für neue Zielgruppen: Wiedereinsteiger:innen, Eltern, Studierende, pflegende Angehörige
- Entlastung der Stammteams und höhere Personalsicherheit
Herausforderungen
- Mehr Koordinationsaufwand, besonders bei dezentralen Standorten
- Teamdynamik kann leiden, wenn Flexkräfte zu selten im selben Bereich arbeiten
- Höhere Anforderungen an Einarbeitung und Informationsweitergabe
- Gleichbehandlung & Anerkennung: Springer dürfen nicht als „Lückenbüßer“ wahrgenommen werden
Praxisbeispiel: Charité Berlin & St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort
Die Charité Berlin betreibt einen der größten Pflegepools Deutschlands – mit über 500 Mitarbeitenden. Das Konzept: Pflegekräfte entscheiden selbst, wann, wie oft und in welchem Bereich sie arbeiten. Die Dienste können flexibel über ein Online-Tool gewählt werden.
Auch das St. Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort hat erfolgreich einen Pflegepool etabliert. Mitarbeitende im Flexteam geben ihre Wunschdienste online ab und werden gezielt dort eingesetzt, wo Bedarf besteht. Das Modell richtet sich an Pflegekräfte mit Kindern, in Fort- oder Weiterbildung oder mit pflegebedürftigen Angehörigen. Die Bezahlung ist gleichwertig zur Stammbelegschaft. In einer internen Befragung berichteten die Teams von einer hohen Zufriedenheit – sowohl bei den Poolkräften als auch in den Regelteams.
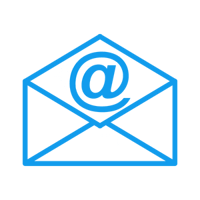
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie wertvolle Tipps für Ihr Pflege-Recruiting.
6-Stunden-Schichtmodell
Das 6-Stunden-Schichtmodell ist ein alternatives Arbeitszeitkonzept, das bewusst auf kürzere, dafür intensivere Schichten setzt – meist ohne die gesetzlich vorgeschriebene Pausenzeit. In der Pflege eignet sich dieses Modell besonders für hochbelastete Bereiche, etwa Intensivstationen, Notaufnahmen oder Demenzpflege, wo lange Dienste nachweislich zu Erschöpfung, Fehlerhäufung und Fluktuation führen.
Die tägliche Arbeitszeit beträgt exakt sechs Stunden – z. B. von 6:00 bis 12:00 Uhr oder 13:00 bis 19:00 Uhr. Um den 24-Stunden-Betrieb zu sichern, wird der Tag in mehrere Kurzschichten unterteilt (3–4 pro Tag).
Vorteile für Arbeitgeber
- Weniger Fehlzeiten: Laut YER sinken Krankmeldungen deutlich – auch bei körperlich belastenden Tätigkeiten
- Höhere Konzentration & geringere Fehlerquote: Besonders relevant für die Pflege von Intensivpatient:innen oder Demenzbetroffenen
- Weniger Burnout-Symptome: Mitarbeitende berichten von mehr Energie nach der Arbeit
- Attraktivität für Teilzeitkräfte, Eltern & Wiedereinsteiger:innen
- Stärkere Teamresilienz: Kürzere Dienste ermöglichen eine bessere Dienstrotation bei Ausfällen
Herausforderungen
- Mehr Schichtübergaben und damit potenziell höherer Koordinationsaufwand
- Höherer Personalbedarf, um dieselbe Versorgungszeit abzudecken
- Tarifliche Fragen zur Vergütung und zu Zeitzuschlägen müssen klar geregelt werden.
- Nicht flächendeckend einsetzbar, aber als Zusatzmodell wertvoll
Fazit für Arbeitgeber
Das 6-Stunden-Modell ist kein Allheilmittel, aber ein hochinteressantes Zusatzangebot für Pflegekräfte in sensiblen, anstrengenden Bereichen – und ein klares Signal an Bewerber:innen: Wir nehmen Belastung und Gesundheit ernst.
Wer als Arbeitgeber hier testweise startet (etwa auf Intensivstationen oder in der Kurzzeitpflege), kann nicht nur die Dienstbelastung senken, sondern auch das eigene Image als zukunftsorientierte Einrichtung stärken.

Welches Modell passt zu welcher Einrichtung? Empfehlungen für Krankenhäuser, ambulante Dienste & Pflegeheime
Nicht jedes Arbeitszeitmodell eignet sich für jede Pflegeeinrichtung. Entscheidende Faktoren sind die Art der Versorgung, die Teamstruktur, der Betrieb rund um die Uhr sowie die Erwartungen der Mitarbeitenden. Im Folgenden finden Sie konkrete Empfehlungen, was wo sinnvoll umsetzbar ist und warum.
Krankenhäuser
Krankenhäuser benötigen rund um die Uhr eine lückenlose Versorgung. Gleichzeitig herrscht hoher Fachkräftemangel, insbesondere auf den Normalstationen, in der Intensivpflege und im OP.
Empfohlene Modelle:
- Flex-Pool: Besonders effektiv zur Abdeckung kurzfristiger Ausfälle und Urlaube. Ideal für große Häuser mit wechselnden Belastungsspitzen (z. B. Notaufnahme, IMC, OP).
- Wahlarbeitszeit & Wunschdienstplanung: Auf Normalstationen mit stabilen Teams fördert dieses Modell Motivation und Planbarkeit.
- 4-Tage-Woche (komprimiert): In Pilotbereichen getestet, z. B. Innere Medizin oder Gynäkologie. Ermöglicht längere Erholungsphasen bei gleichbleibender Arbeitszeit
- Jahresarbeitszeit: Gut geeignet in saisonal belasteten Fachbereichen (z. B. Pädiatrie oder Grippezeiten).
- 6-Stunden-Schichten: Optional in Hochbelastungsbereichen wie Intensivstationen oder Onkologie zur Burnout-Prävention.
Tipp: Kombinationen sind oft erfolgreicher als reine Umstellungen – z. B. Pflegepool plus Wahlarbeitszeit für freiwillige Dienste.
Ambulante Pflegedienste
Ambulante Dienste kämpfen besonders mit Tourenplanung, geteilten Diensten und Vereinbarkeitsproblemen. Gleichzeitig bieten sie viele Chancen für flexible Modelle.
Empfohlene Modelle:
- Wahlarbeitszeit & Wunschdienste: Besonders effektiv zur besseren Tourenabdeckung, ideal für Teilzeitkräfte, Eltern und Studierende.
- 4-Tage-Woche (reduziert oder in Teilzeit): Geringere Diensttage mit effizienterer Tourenplanung stärken die Zufriedenheit – wie das Beispiel DRK Seelze zeigt.
- Flex-Pools: Regionale Flexteams für Wochenenden, Stoßzeiten oder Urlaubsvertretungen – z. B. bei Verbundträgern.
- Gleitzeit in Verwaltung & Rufbereitschaft: Für nicht-pflegerische Dienste bietet Gleitzeit Erleichterung in der Tagesstruktur.
Tipp: Geteilte Dienste möglichst abschaffen oder durch Modulsysteme (z. B. „Vormittagstour“, „Abendrunde“) ersetzen.
Stationäre Pflegeheime
Pflegeheime arbeiten mit stabilen Teams und oft langjährigen Pflegekräften. Gleichzeitig steigt der Bedarf an flexiblen Lösungen zur Erholung und Planbarkeit.
Empfohlene Modelle:
- 7/7-Modell: Sehr erfolgreich in Einrichtungen wie DSG Seniorenstifte. Erlaubt verlässliche Personalplanung und Wochenblöcke mit Erholungsphasen.
- Flex-Pool: Ideal zur Abdeckung von Spät- und Wochenenddiensten mit Wunschzeitmodellen.
- Gleitzeit & Funktionszeit: Für soziale Betreuung, Hauswirtschaft und Pflegeassistenzdienste gut integrierbar.
- 6-Stunden-Schichten: Besonders sinnvoll in Demenzpflege oder Palliativbereichen mit hoher emotionaler Belastung.
Tipp: Pflegeheime profitieren besonders von stabilen, rhythmischen Dienstplänen mit Beteiligung des Teams – z. B. durch Selbstplanung in Monatszyklen.
Employer Branding mit modernen Arbeitszeitmodellen gezielt stärken
Moderne Arbeitszeitmodelle wirken nicht nur nach innen. Sie sind ein zentrales Element für Ihre Arbeitgebermarke. Pflegekräfte achten heute stärker denn je darauf, wie viel Mitbestimmung, Planbarkeit und Lebensqualität ein Arbeitgeber bietet.
Wer flexible Modelle nicht nur anbietet, sondern auch sichtbar kommuniziert, verbessert seine Chancen im Recruiting und in der Mitarbeiterbindung deutlich.
Flexible Modelle sichtbar machen – in Stellenanzeigen & Jobportalen
Erwähnen Sie Arbeitszeitmodelle prominent und konkret:
Nicht nur „flexible Arbeitszeiten“, sondern z. B.:
- „4-Tage-Woche auf Wunsch – ohne Gehaltsverzicht“
- „Pflegepool mit Wunschdiensten – Sie sagen, wann Sie arbeiten“
- „Teilzeitmodelle ab 2 Diensten pro Woche – auch für Eltern“
Nutzen Sie dazu klare Überschriften, Icons und Bulletpoints in Ihren Stellenanzeigen. So sprechen Sie gezielt Bewerber:innen an, die Flexibilität suchen, und heben sich von anderen Arbeitgebern ab.
Mitarbeiter-Stories & Testimonials auf der Karriereseite nutzen
Echte Erfahrungsberichte sind besonders überzeugend. Lassen Sie Mitarbeitende erzählen, warum sie sich für ein bestimmtes Modell entschieden haben – etwa:
„Seit ich im 7/7-Modell arbeite, habe ich wieder ein echtes Wochenende. Ich bin entspannter und das spüren auch unsere Bewohner.“Bilder, Zitate oder Kurzvideos schaffen Vertrauen und zeigen, dass Ihre Versprechen gelebte Realität sind.
Weitere Tipps, wie Sie das aufbauen, finden Sie im Care Rockets Ratgeber:
→ Employer Branding in der Pflege – So überzeugen Sie Pflegekräfte
Social Media & regionale Plattformen gezielt nutzen
Pflegekräfte informieren sich heute nicht nur auf klassischen Jobportalen, sondern auch auf:
- Instagram, Facebook, LinkedIn
- Spezifischen Pflegeplattformen wie pflegestellen.de oder pflegenetzwerk-deutschland.de
- In lokalen Gruppen (z. B. „Pflegekräfte Köln & Umgebung“)
Dort wirken kurze Posts mit Fokus auf flexible Arbeitszeiten besonders gut:
- Pflegejob mit 4-Tage-Woche in Hamburg?
- Wunschdienstplanung & echter Teamgeist?
- Jetzt bewerben bei [Einrichtungsname] – wir planen mit dir.
Weitere Tipps hierzu finden Sie im Care Rockets Ratgeber:
→ Social-Media-Marketing für die Pflegebranche
Regionale Keywords gezielt einbauen
Für gute Sichtbarkeit in Google & Co. ist es hilfreich, lokale Arbeitszeitvorteile aktiv zu bewerben:
- „Pflegekraft in München gesucht – 6-Stunden-Schicht möglich“
- „Wunschdienstmodell für ambulante Pflege in Dortmund“
- „Springerpool Pflege in Frankfurt – wir passen zu deinem Leben“
Das erhöht nicht nur die Auffindbarkeit durch Pflegekräfte vor Ort, sondern stärkt auch Ihre relevante Arbeitgebermarke in Ihrer Region.
Rechtliches zur Umsetzung: Was Pflegeeinrichtungen beim Einführen neuer Arbeitszeitmodelle beachten müssen
Moderne Arbeitszeitmodelle bieten Chancen – aber sie müssen rechtlich sauber umgesetzt werden. Arbeitgeber sollten dabei auf drei zentrale Ebenen achten: Gesetzgebung, Mitbestimmung und Vertragliches.
Arbeitszeitgesetz & Tarifgrenzen
Das deutsche Arbeitszeitgesetz (ArbZG) setzt klare Rahmenbedingungen:
- Maximal 8 Stunden/Tag, verlängerbar auf 10 Stunden, wenn im 6-Monats-Schnitt 8 Stunden nicht überschritten werden.
- Mindestens 11 Stunden Ruhezeit zwischen zwei Diensten
- Nach Nachtarbeit mindestens 48 Stunden am Stück frei.
- 12-Stunden-Schichten sind nur mit großzügigen Pausen (z. B. 2 Stunden) und Nettoarbeitszeit von maximal 10 Stunden zulässig.
- Verstöße können zu Bußgeldern oder Haftung im Schadensfall führen.
Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen können zusätzliche Regelungen enthalten, z. B. zur Wochenendverteilung oder Schichtzulagen. Diese müssen bei der Einführung neuer Modelle angepasst oder ergänzt werden.
Empfehlung: Vor Einführung neuer Modelle immer rechtliche Beratung einholen (z. B. Arbeitgeberverband, Gewerkschaft, Fachanwalt).
Mitbestimmung durch den Betriebsrat
Laut § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei:
- Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit
- Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage
- Pausenregelungen
Das bedeutet: Neue Arbeitszeitmodelle sind zustimmungspflichtig. Eine Betriebsvereinbarung schafft klare Regeln – z. B. zu Pilotphasen, Rückkehroptionen, Auswertungen und Mitwirkung der Teams.
Auch in Einrichtungen ohne Betriebsrat sollte das Pflegeteam frühzeitig eingebunden werden – Beteiligung erhöht die Akzeptanz und Identifikation mit dem Modell.
Arbeitsverträge und Teilzeitregelungen prüfen
Bei Veränderungen der Arbeitszeit sind vertragliche Anpassungen meist erforderlich:
- Von Wechselschicht zu Dauernachtwache: schriftlich festhalten + ggf. Wegfall von Zulagen regeln
- 50/50-Modell: Vereinbarung über Jahresarbeitszeitkonto mit Regelung zu Über-/Unterstunden, Fristen, Auszahlung
- Reduktion auf 4-Tage-Woche: vertragliche Teilzeitvereinbarung erforderlich
Wichtig: Transparenz & Gleichbehandlung – Angebote dürfen nicht diskriminierend wirken (z. B. nur für junge Beschäftigte)
Dienstplan-Software und digitale Zeiterfassung
Flexible Modelle brauchen digitale Unterstützung. Geeignet sind Programme wie Optima, TimeCare, Vivendi PEP oder integrierte Lösungen in Pflegesoftware.
Wichtige Funktionen:
- Wunschdienstabfrage & -abgleich
- Prüfung von Ruhezeiten & ArbZG-Verstößen
- Verwaltung von Arbeitszeitkonten & Urlaubsplanung
- Mobile App für Diensttausch & Rückmeldung
Gute Software reduziert Planungsaufwand, Fehler und Konflikte – und schafft Vertrauen.
Schritt-für-Schritt-Plan zur Einführung moderner Arbeitszeitmodelle
1. Bedarf und Zielgruppe analysieren
Welche Probleme gibt es aktuell? Wer profitiert von welchem Modell? (z. B. hohe Fehlzeiten, viele Eltern, Wunsch nach mehr Teilzeit)
2. Passende Modelle auswählen
Je nach Einrichtungstyp (ambulant, stationär, Klinik) das passende Modell identifizieren – z. B. 7/7 im Pflegeheim, Wunschdienste im Krankenhaus.
3. Rechtlich prüfen und Betriebsrat einbinden
Gesetzeslage, Tarifbindung und betriebliche Mitbestimmung klären. Mit dem Betriebsrat oder dem Team einen Umsetzungsrahmen definieren.
4. Pilotphase planen
Ein Team, ein Bereich oder ein Zeitraum – z. B. 6 Monate Testlauf auf Station X mit Rückkehroption und Feedbackschleife.
5. Kommunikation und Schulung
Mitarbeitende informieren, Vorteile und Ablauf transparent erklären. Führungskräfte in Planung, Fairness und Kommunikation schulen.
6. Software und Tools vorbereiten
Dienstplan-Tool prüfen oder einführen, Funktionen wie Wunschdienstabfrage, Regelprüfung und Arbeitszeitkonten aktivieren.
7. Start und Begleitung
Regelmäßig Feedback einholen, Engpässe lösen, Transparenz schaffen. Frühzeitige Anpassungen zeigen: Das Modell wird ernsthaft begleitet.
Fazit: Attraktive Arbeitszeitmodelle machen Pflegeeinrichtungen zukunftssicher
Pflegeeinrichtungen stehen heute mehr denn je vor der Herausforderung, qualifiziertes Personal zu gewinnen, zu halten – und gleichzeitig wirtschaftlich handlungsfähig zu bleiben. Dieser Ratgeber zeigt: Moderne Arbeitszeitmodelle sind kein Luxus, sondern ein strategisches Muss.
Ob 4-Tage-Woche, Pflegepool, Wunschdienst oder Blockmodell – jede Einrichtung kann passende Lösungen finden, die sowohl den betrieblichen Anforderungen als auch den Lebensrealitäten der Mitarbeitenden gerecht werden. Die Beispiele aus der Praxis belegen eindrucksvoll: Flexible Modelle steigern Zufriedenheit, senken Fehlzeiten und erhöhen die Arbeitgeberattraktivität – besonders bei jüngeren Pflegekräften.
Die Umsetzung erfordert Mut, Planung und Mitbestimmung – doch der Aufwand lohnt sich. Wer klein anfängt, Beteiligung fördert und digitale Tools nutzt, schafft Schritt für Schritt eine neue Dienstplankultur. So wird Arbeitszeitgestaltung vom Engpass zum Erfolgsfaktor.
Pflegekräfte finden, die zu Ihren Arbeitszeitmodellen passen?
Care Rockets bringt Sie mit genau den Pflegekräften zusammen, die moderne Arbeitszeitkonzepte wie 4-Tage-Woche, Pflegepool oder Wunschdienstsystem aktiv suchen.
✓ Geprüfte Fachkräfte – bundesweit
✓ Flexibel nach Ihren Einsatzmodellen
✓ Persönliche Beratung & gezieltes Matching


